- Trainer/in: Marion Abate
GRIPS - Uni Regensburg
Suchergebnisse: 1760
Auch im Zeitalter von Photosharing, Videoblogging und Voice over IP stellt Text wohl immer noch das wichtigste Medium der Kommunikation dar. In der Einführungsvorlesung werden theoretische Grundpositionen zu Text und Textbegriffen beleuchtet sowie zentrale Arbeitsmethoden der klassischen und statistischen Computerlinguistik und des Textmining vorgestellt. Die begleitenden Übungen vertiefen die behandelten Themen und geben Studenten die Möglichkeit sich exemplarisch in einzelne Methoden einzuarbeiten.
- Trainer/in: Daniel Isemann
- Trainer/in: Ralf Auer
- Trainer/in: Sandra Schmid
Vorlesung für das Basis-Modul 2013/14
Eliten stellen vielleicht den wichtigsten Faktor der postkommunistischen Systemtransformation dar. In der Vorlesung werden sie unter Bezugnahme auf theoretische Ausführungen und empirische Untersuchungen im Gesamtzusammenhang dieses Prozesses betrachtet. Dabei wird die Entstehung der neuen institutionellen Ordnung – samt Parteien und Parteiensystemen – in den Vordergrund der Analyse gerückt.
- Trainer/in: Ferdinand Kosak
- Trainer/in: Iris Schelhorn
- Trainer/in: Markus Forster
- Trainer/in: Markus Forster
- Trainer/in: Mareike Artmann
- Trainer/in: Manuela Zachmayer
Studierende können nach dem Kursbesuch empirische Projekte realisieren, wie sie in Seminar-, Bachelor- und Masterarbeiten, sowie in Forschung und Berufspraxis häufig vorkommen. Die Ökonometrie-Software EViews von IHS bietet eine umfangreiche Funktionalität für alle Aspekte der empirischen Wirtschaftsforschung, einschließlich Datenaufbereitung, Visualisierung von Daten, Schätzen und Testen ökonometrischer Modelle, sowie der Dokumentation dieser Analyseschritte. Die praktische Realisierung im Kurs erfolgt durch einfache Programmierung in EViews, da Programmierung u.a. die Qualität und Replizierbarkeit empirischer Analysen erhöht. Vorkenntnisse in Statistik, Ökonometrie oder EViews, sowie im Programmieren können hilfreich sein, sind aber nicht unbedingt erforderlich.
pie_info.pdf (https://knoppik.app.ur.de/edu/docs/pie_info.pdf)
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf der Homepage (https://www.uni-regensburg.de/wirtschaftswissenschaften/vwl-knoppik/)
- Trainer/in: Christoph Knoppik
Dozent: Mag.rer.nat. Matthias Reinweber (Dipl.-Psych.)
Zeit: Donnerstag, 14-18 Uhr
Raum: Pt. 4.0.6.
Beginn: 25.4.2013
Das EmPra behandelt dieses Semester den Bystander Effekt und die damit verbunden psychologischen Prozesse. Die Studierenden werden dazu in 2-3 Kleingruppen Untersuchungen am Computer durchführen. Grundlegendes Ziel dieser Untersuchungen ist es zu klären, welchen Einfluss die Manipulation der Schwierigkeit einer Hilfesituation auf die Bereitschaft zu helfen hat und ob es hierbei zu Unterschieden bei der Anzahl der umstehenden Personen (Bystander) kommt. Zusätzlich werden in den Kleingruppen experimentelle Manipulationen ausgearbeitet um die verschieden Prozesse von Erfassung der Situation bis zum Einschreiten und Helfen zu manipulieren (Verantwortungsdiffusion, pluralistische Ignoranz, Bewertungsangst).
- Trainer/in: Matthias Reinweber
Diese Veranstaltung soll einen praxisorientierten Einblick in zentrale Themen, Aufgabenfelder und Methoden der empirischen Bildungsforschung im Kontext Schule ermöglichen. Neben einer eingehenden inhaltlichen Auseinandersetzung mit aktuellen Forschungsgegenständen wie der professionellen Kompetenz von Lehrkräften, Qualitätsmerkmalen von Unterricht, (inter-)nationalen Leistungsvergleichsstudien oder Fragen der Bildungsgerechtigkeit liegt der Fokus vor allem darauf, das grundlegende „Handwerkszeug“ zu erwerben, um wissenschaftliche Studien und Befunde aus dem Bildungskontext kritisch analysieren und interpretieren zu können – nicht zuletzt im Hinblick auf die Konsequenzen für das eigene Wirken, z. B. als zukünftige Lehrkraft.
- Trainer/in: Laura Simböck
Die von ökonomischen Standard-Modellen implizierte Konvergenz von Pro-Kopf-Einkommen ist im weltweiten Maßstab nicht zu beobachten. Aus makroökonomischer Perspektive wird untersucht, welche Institutionen die Voraussetzung für reale Konvergenz der Entwicklungsländer bilden. Aus mikroökonomischer Perspektive wird untersucht, welche Informations- und Anreizprobleme auf Land-, Arbeits-, Kredit- und Versicherungsmärkten Entwicklungshemmnisse darstellen und durch welche institutionellen Arrangements diese überwunden werden können.
Kurzinfo zum Kurs in ent_info.pdf .
http://www.wiwi.uni-regensburg.de/knoppik/edu/docs/ent_info.pdf
- Trainer/in: Christoph Knoppik
Die Übung verfolgt das Ziel, Studierenden einen fundierten kultur- und literaturgeschichtlichen Überblick zum slavischen und osteuropäischen Raum zu vermitteln. Daher wollen wir an Sekundärtexten sowie ausgewähltem Primärmaterial exemplarisch (insbesondere ältere) kulturgeschichtliche Phänomene erarbeiten und besser verstehen. Welche Ausdrucksformen waren besonders beliebt? Woher kamen wichtige Impulse und welche kulturellen Kontakte gab es?
Studierende sollen sich Orientierungswissen erarbeiten und dann erklären können, was z.B. für das Mittelalter typisch ist. Wie stellen sich Renaissance, Humanismus und Barock in unserer Kulturregion dar? Warum hatte die Aufklärung einen anderen Stellenwert, je nach Land? Und schließlich, was bedeuten Romantik, Realismus und Moderne in Imperien für Titularnationen und staatenlose Völker?
Osteuropa wird dabei in seiner internen Komplexität beleuchtet, es wird deutlich werden, was z.B. orthodoxe slavische Länder von katholischen unterscheidet bzw. welche Erscheinungen an bestimmte historische Gegebenheiten gebunden waren.
- Trainer/in: Yuliia Brytyk
- Trainer/in: Naomi Cliett
- Trainer/in: Sabine Koller
- Trainer/in: Nelly Krivic
- Trainer/in: Mirja Lecke
- Trainer/in: Elisa Mucciarelli
Liebe Teilnehmer*innen,
ich freue mich, dass wir in diesem Semester eine so große Gruppe sind, die sich in den vier Sitzungen mit dem Erklären beschäftigen wird.
Aufgrund der Corona-Pandemie wird dieser GRIPS-Kursraum zunächst unser "einziger" Kursraum sein, bis wir hoffentlich in der zweiten Semesterhälfte zu den veröffentlichten Seminarterminen grünes Licht für reale Treffen bekommen.
Die Seminarbeschreibung haben Sie bereits in LSF bzw. im Vorlesungsverzeichnis einsehen können:
Das Seminar widmet sich der Methode des mündlichen Erklärens, das zwar eine zentrale Tätigkeit von Lehrkräften darstellt, aber dazu selten gezielte Übungsmöglichkeiten bestehen. Sie bekommen in der Veranstaltung die Gelegenheit eigene kurze Erklärungen zu konzipieren, zu videografieren und diese aufgrund von Feedback von Kommiliton*innen und theoretischen Inputs zu überarbeiten.
Das Seminar findet in diesem Semester in Kooperation mit einem Seminar aus dem Institut für Bildende Kunst und Ästhetische Erziehung statt. Die Erklärungen werden sich deshalb im fächerverbindenden Themenbereich "Optik und Sehen" verorten, der spannende und komplexe Fragen für Biolog*innen und Künstler*innen bietet. Zum Beispiel: Wie funktioniert die Farbwahrnehmung? Wie wird Farbe digital erzeugt? Warum kann man über die Farbbezeichnung streiten? Wie wird im Auge scharf gestellt? Und was hat das mit Kameratechnik zu tun?
In einem weiteren Schwerpunkt werden wir uns in einer Sitzung mit dem Umgang mit Komplexität und Nichtwissen im Biologieunterricht beschäftigen.
Aufgrund der aktuellen Situation sowie der großen Gruppengröße, habe ich mich gemeinsam mit Herrn Weich (Kooperationspartner; Dozent aus der Kunstpädagogik) dazu entschieden, den Fokus von mündlichen Erklärungen in einer fiktiven Unterrichtssituation auf die Erstellung von Erklärvideos zu fokussieren.
- Trainer/in: Christina Ehras
In diesem interdisziplinären Seminar möchten wir uns explorativ der Kompetenz guten Erklärens sowie Kategorien des Erklärens von Lehrkräften im Musikunterricht nähern. Dabei kombinieren wir eine theoretische Herangehensweise mit verschiedenen Praxiskomponenten. Neben Unterrichtsbeobachtungen erfahrener Lehrkräfte wird es an einem Sondertermin die Möglichkeit geben, Studierenden der Fächer NWT und Kunst musikalische Fachinhalte feedback- bzw. feedforward-orientiert zu erklären.
Dieser Sondertermin wird vom Stundenkontingent her in die zu erwartende Seminarzeit mit eingerechnet und findet aller Voraussicht nach am Freitag, 17.06. von 14 – 17 Uhr an der Universität Regensburg statt.
- Trainer/in: Mario Frei
- Trainer/in: Daria Podwika
In der Vorlesung werden die theoretischen Grundlagen der
kulturwissenschaftlichen und interdisziplinären Ernährungs- und
Krisenforschung vermittelt und in ih-ren historischen Bezügen
dargestellt, um darauf aufbauend die Strukturen und Bedingungsfaktoren
der Ernährung in der Gegenwart darstellend und analysieren zu können.
Dies dient als Grundlage, um Ernährungsnarrative und -praxen in
Beziehung zu den Inhalten des Faches setzen zu können. Kommentar Die
postmodernen Gesellschaften haben an der Schwelle zum 21. Jahrhundert
Identitätskonzepte und Kulturformen herausgebildet, die stärker auf
Lebensstilen als auf Herkunft oder Beruf basieren. Die Corona-Pandemie
hat den raschen Wandel, der seit den 1990er Jahren in Gang gesetzt
wurde, noch einmal deutlich be-schleunigt. Dabei zeigt sich, dass Krisen
als Katalysatoren auch in der Vergangenheit große Wirkkraft besessen
haben. Um diese Transformationsprozesse darstellen und analysieren zu
können, bietet sich die Indikatorfunktion der Ernährung in besonderem
Maße an. Die gegenwärtigen Entwicklungen können aber nur erkannt werden,
wenn man sie als Resultat einer historischen Genese begreift. In der
Vorlesung sollen daher die Grundstruktu-ren und Entwicklungslinien der
europäischen Esskultur von den frühen Hochkulturen über die Antike und
das europäische Mittelalter bis in die Zukunft aufgezeigt werden.
- Trainer/in: Anna Häckel-König
Die Nahrungsforschung hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem zentralen Themenfeld der Vergleichenden Kulturwissenschaft entwickelt. Dabei fokussiert unser Fach inzwischen auch zunehmend auf den Ernährungsalltag. Allerdings befinden sich jene Ernährungsmuster, die sich in der langen Friedens- und Wohlstandsphase der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts herausgebildet haben, seit gut einem Jahrzehnt wieder in einem atemberaubend dynamischen Transformationsprozess: Essen hat sich von einer durch Tradition und Enkulturation sowie Schicht- und Klassenzugehörigkeit determinierten Praxis zum Ausdruck von Lebensstil gewandelt. Lebensstile sind dabei zu Ernährungsstilen geworden. Vor diesem Hintergrund erscheint die Ernährung als neue Leitperspektive globaler Gesellschaften. Kommunikation über Ernährung ist Kommunikation über Selbstverortung und Weltdeutung – in der Ernährungsfrage bündeln sich Narrative über die Bewältigung globaler Krisen.
Das Projektseminar plant, sich zunächst den gegenwärtigen Ernährungspraxen und Trends zu widmen, dann aber vor allem narrative, mediale und netzbasierte Diskurse zu identifizieren, ihre Struktur in kulturwissenschaftlicher Perspektive zu kategorisieren und zu analysieren.
- Trainer/in: Lavinia Eifler
- Trainer/in: Gunther Hirschfelder
- Trainer/in: Antonia Reck
Die Nahrungsforschung hat sich im Übergang zum 21. Jahrhundert zu einem zentralen Themenfeld der Vergleichenden Kulturwissenschaft entwickelt. Als disziplinäres Alleinstellungsmerkmal lässt sich dabei unser Fokus auf den Ernährungsalltag hervorheben. Essen und Trinken sind geprägt durch Tradition und Enkulturation, können Schicht- und Klassenzugehörigkeit ausdrücken und werden heute v.a. als Ausdruck individueller und kollektiver Lebensstile wahrgenommen. Diese verstetigen sich inzwischen als spezifische Ernährungsstile. Ernährung ist gewissermaßen eine neue Leitperspektive globaler Gesellschaften. Kommunikation über Ernährung ist Kommunikation über Selbstverortung und Weltdeutung – und in der Ernährungsfrage bündeln sich schließlich auch Narrative über die Bewältigung globaler Krisen.
Die Covid-19-Pandemie stellt eine Krise dar, die in kurzer Zeit große Auswirkungen auf den Alltag der Menschen weltweit hatte. Im Seminar soll aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht werden, wie Ernährungsdiskurse- und praxen auf die Pandemie reagieren. Dies umfasst mediale, narrative und netzbasierte Diskurse sowie alltägliche Handlungsmuster, die mit kulturwissenschaftlichen Methoden identifiziert und analysiert werden sollen. Die thematische Ausrichtung ist strukturell durch die Fachdiskurse vorgegeben, kann aber auch durch die Präferenzen der Studierenden mitbestimmt werden.
- Trainer/in: Lavinia Eifler
- Trainer/in: Gunther Hirschfelder
Alle Dokumente und Wissensmanagements zum Thema Erstsemesterbetreuung kommen hier rein.
- Trainer/in: Ferdinand Michel
- Trainer/in: Fachschaft Psychologie
Dieser Kurs bietet für nicht-konsekutive Masterstudierende die Möglichkeit, kompakte Einblicke in das Fachverständnis sowie die Arbeitsweise der Vergleichenden Kulturwissenschaft zu erhalten. Konsekutive Masterstudierende können ihre bisherigen Fachkenntnisse weiter vertiefen.
Die Beschäftigung mit fachgeschichtlichen Traditionslinien – von den Anfängen einer wissenschaftlichen Volkskunde bis zur heutigen Vergleichenden Kulturwissenschaft – und die Betrachtung von Forschungsfeldern, Theorien sowie Methoden schaffen die Grundlage für eine Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Aufgaben des Faches innerhalb einer internationalen Wissenschaftslandschaft.
- Trainer/in: Karin Lahoda
Dieser Kurs bietet Studierenden des Studiengangs Public History und Kulturvermittlung kompakte Einblicke in das Fachverständnis sowie die Arbeitsweise der Vergleichenden Kulturwissenschaft. Konsekutive Masterstudierende können ihre bisherigen Fachkenntnisse weiter vertiefen.
Die Beschäftigung mit fachgeschichtlichen Traditionslinien – von den Anfängen einer wissenschaftlichen Volkskunde bis zur heutigen Vergleichenden Kulturwissenschaft – und die Betrachtung von Forschungsfeldern, Theorien sowie Methoden schaffen die Grundlage für eine Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Aufgaben des Faches innerhalb einer internationalen Wissenschaftslandschaft.
- Trainer/in: Sebastian Gietl
Dieser Kurs bietet Studierenden des Studiengangs Public History und Kulturvermittlung kompakte Einblicke in das Fachverständnis sowie die Arbeitsweise der Vergleichenden Kulturwissenschaft. Konsekutive Masterstudierende können ihre bisherigen Fachkenntnisse weiter vertiefen.
Die Beschäftigung mit fachgeschichtlichen Traditionslinien – von den Anfängen einer wissenschaftlichen Volkskunde bis zur heutigen Vergleichenden Kulturwissenschaft – und die Betrachtung von Forschungsfeldern, Theorien sowie Methoden schaffen die Grundlage für eine Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Aufgaben des Faches innerhalb einer internationalen Wissenschaftslandschaft.
- Trainer/in: Sebastian Gietl
Dieser Kurs bietet Studierenden des Studiengangs Public History und Kulturvermittlung kompakte Einblicke in das Fachverständnis sowie die Arbeitsweise der Vergleichenden Kulturwissenschaft. Konsekutive Masterstudierende können ihre bisherigen Fachkenntnisse weiter vertiefen.
Die Beschäftigung mit fachgeschichtlichen Traditionslinien – von den Anfängen einer wissenschaftlichen Volkskunde bis zur heutigen Vergleichenden Kulturwissenschaft – und die Betrachtung von Forschungsfeldern, Theorien sowie Methoden schaffen die Grundlage für eine Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Aufgaben des Faches innerhalb einer internationalen Wissenschaftslandschaft.
- Trainer/in: Sebastian Gietl
Dieser Kurs bietet Studierenden des Studiengangs Public History und Kulturvermittlung kompakte Einblicke in das Fachverständnis sowie die Arbeitsweise der Vergleichenden Kulturwissenschaft. Konsekutive Masterstudierende können ihre bisherigen Fachkenntnisse weiter vertiefen.
Die Beschäftigung mit fachgeschichtlichen Traditionslinien – von den Anfängen einer wissenschaftlichen Volkskunde bis zur heutigen Vergleichenden Kulturwissenschaft – und die Betrachtung von Forschungsfeldern, Theorien sowie Methoden schaffen die Grundlage für eine Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Aufgaben des Faches innerhalb einer internationalen Wissenschaftslandschaft.
- Trainer/in: Sebastian Gietl
Dieser Kurs bietet Studierenden des Studiengangs Public History und Kulturvermittlung kompakte Einblicke in das Fachverständnis sowie die Arbeitsweise der Vergleichenden Kulturwissenschaft. Konsekutive Masterstudierende können ihre bisherigen Fachkenntnisse weiter vertiefen.
Die Beschäftigung mit fachgeschichtlichen Traditionslinien – von den Anfängen einer wissenschaftlichen Volkskunde bis zur heutigen Vergleichenden Kulturwissenschaft – und die Betrachtung von Forschungsfeldern, Theorien sowie Methoden schaffen die Grundlage für eine Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Aufgaben des Faches innerhalb einer internationalen Wissenschaftslandschaft.
- Trainer/in: Sebastian Gietl
- Trainer/in: Alexandra Clobes
- Trainer/in: Andreas Loscher
- Trainer/in: Jerzy Mackow
Seit Sommer 2015 steht Deutschland vor der Herausforderung der Aufnahme und Integration der vornehmlich aus den vor Bürgerkrieg und Terror geflüchteten Menschen aus Syrien und dem Irak. Auch in Stadt und Landkreis Regensburg haben mehrere tausend Menschen Unterkunft gefunden, die wiederum prägend auf die bisherige Alltagskultur der Region wirken.
Im Mittelpunkt des Seminars stehen für uns die Wechselwirkungen zwischen Ethnizität und Ernährung der Geflüchteten, da gerade der Bereich der Esskultur besonders ergiebig für die Erforschung von Bewältigungsstrategien und Integrationsgrad migrierter Menschen ist. Mögliche Forschungsfragen lauten: Auf welche Weise erfolgt die Versorgung der Menschen in Erstaufnahme- und Gemeinschaftsunterkünften und wie werden die dort dargereichten Nahrungsmittel angenommen und zubereitet? Welchen Stellenwert nimmt das Kochen traditioneller Gerichte im Zuge der Akkulturationssituation ein und wie wird Gastfreundschaft gelebt? Führt die Aufnahme der Geflüchteten zu Veränderungen in Supermarktangeboten und Gastronomie der Stadt?
Ergebnisse hierzu sollen durch Eigenleistung der Studierenden im Zuge von Feldforschungs- und Interviewstudien durch die Annäherung an ein sensibles, aber gesellschaftlich hochrelevantes Forschungsfeld gewonnen werden. Die Interaktionspartner sollen in diesem Kontext von den Studierenden eigenständig identifiziert und zur Mitarbeit bewogen werden. Der Fokus liegt auf migrantischen Interviewpartnerinnen und -partnern, aber auch die heimische Perspektive soll zum Tragen kommen.
- Trainer/in: Patrick Pollmer
Wie Kultur in Bild und Ton festzuhalten sei, darüber diskutierten bereits 1900 auf dem Internationalen Völkerkundekongress Forscher in Paris. Jene (audio-)visuellen Dokumente, für die Entdecker und Abgesandte der Nationalmuseen von den europäischen Kolonien bis in die unerforschtesten Ecken der Welt reisten, blieben allerdings nicht lange ein Forschungsgegenstand. Legendäre Filme wie Robert J. Flahertys „Nanook Of The North“ (1922) und „Moana“ (1926) brachten exotische Lebensweisen – von den Inuit bis zu den Völkern der Südsee – als Kassenschlager in die Kinos. Von den Museen und Kinos eroberte der ethnologische Film in den 1960er-Jahren schließlich auch das Fernsehen und die Filmfestivals. Heute ist er gleichsam Industrie und Instrument.
Die außenstehende Perspektive auf Kultur stellte dabei ebenso ein Problemfeld für die Filmemacher dar, wie die Art, mit der sie Kultur inszenierten. Zwischen der romantisierenden, lukrativen Darstellung von Stereotypen und der intensiven aber aufwändigen Langzeitdokumentation von sozialen Beziehungen, Riten, Traditionen und Lebensweisen, die im Sinne des humanitären Dokumentarfilms auch eine Bewahrung vor dem Vergessen bedeutete, wurde der ethnologische Film immer wieder kontrovers diskutiert. Um das breite Feld zu vermessen, spannt das Seminar deshalb einen Bogen über die letzten hundert Jahre des ethnologischen Films. Ausgehend von filmischen Beispiele von Robert J. Flaherty (Moana, 1926) über Paul Lieberenz (Urwaldzwerge in Zentralafrika, 1941), Jean Rouch (Chronique d’un été, 1961) bis hin zu Edmund Ballhaus (Über Der Kohle Wohnt Der Mensch, 1995) soll im Seminar die theoretische und methodische Diskussion von Dokumentarfilm als Forschungsinstrument nachvollzogen werden.
Die Seminarteilnehmer eignen sich dabei Wissen über die Theorie und Geschichte visueller Kulturanthropologie, im Besonderen die Instrumentalisierung von Dokumentarfilm als Forschungsmethode, an. Über prominente Protagonisten des ethnologischen Films aus Gegenwart und Vergangenheit erwerben sie grundlegende Kompetenzen für das Lesen und den Einsatz von Bildern zwischen Forschung und Filmindustrie.
- Trainer/in: Laura Niebling
Das Basismodul bietet einen umfangreichen Diskussionsraum zu historischen Ereignissen und Grundideen Europas und den Problemen und Herausforderungen, mit denen die Europäische Union als politisches Konstrukt nach dem Kalten Krieg und dem Zusammenbruch des europäischen Kommunismus konfrontiert ist. Kern des Moduls ist die Verarbeitung der wichtigsten Begriffe wie Europa / Europa, Konflikte und Krisen, Staat und Nation, Minderheiten, Selbst- und Fremdbild, Integration und Desintegration, europäische Erinnerung, europäische Identität und europäische Werte.
Das Basismodul besteht aus zwei Teilen:
Im ersten Teil „Europäische Visionen und Konzepte aus historischer Perspektive“ werden die historischen Ereignisse vom Westfälischen Frieden bis zum Zweiten Weltkrieg beleuchtet, die Ordnungsvorstellungen und Europadiskurse der wichtigsten Visionäre diskutiert und die Entwicklung verschiedener europäischer Konzepte analysiert.
Der 2. Teil, "Europäische Union: Integration und Herausforderungen", untersucht die verschiedenen Modelle und Theorien der europäischen Integration sowie die EU-Entwicklungsstrategien, die Ziele und Mechanismen der Gründung der Europäischen Union nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Analyse grundlegender Probleme und Herausforderungen, mit denen Europa nach dem Kalten Krieg und dem Zusammenbruch des europäischen Kommunismus konfrontiert war, ist ein weiteres Ziel des Seminars.
Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls (WiSe + SoSe) sind folgende Kompetenzen zu erwarten:
- Fachliche Kenntnisse zur europäischen Integration und zu Hintergrunde der Funktionsweise der Europäischen Union
- Analysefächigkeit in unterschiedlichen Disziplinen
- Schulung des interdisziplinären und vernetzten Denkens
- Auseinandersetzung mit Blickwinkeln anderer Disziplinen
- Selbständiges Erarbeiten unterschiedlichen Disziplinen
- Entwicklung der Transferkompetenzen
- Selbständiges wissenschaftliches Arbeiten und Recherchieren
- Trainer/in: Svetlana Suveica
Der Kurs dient der Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung in Analysis im 1. Staatsexamen (Lehramt Gymnasium). Anhand früherer Examensaufgaben sollen die erforderlichen Kenntnisse aus der Funktionentheorie, der reellen Analysis und aus der Theorie der (gewöhnlichen) Differentialgleichungen wiederholt und die wesentlichen Techniken zum Lösen der Aufgaben eingeübt werden.
Themen (gemäß LPO I): Folgen und Reihen; Differentialrechnung einer und mehrerer Veränderlicher (insbesondere Stetigkeit, Differentiation, Entwicklung in Potenzreihen); Integralrechung einer und mehrerer Veränderlicher (insbesondere Riemannintegral, Volumen- und Oberflächenintegrale); Gewöhnliche Differentialgleichungen (insbesondere Existenz- und Eindeutigkeitssätze für Anfangswertprobleme, elementare Lösungsmethoden, lineare Differentialgleichungen, Systeme linearer Differentialgleichungen); Aufbau des Körpers der komplexen Zahlen; Komplexe Differenzierbarkeit (insbesondere holomorphe und meromorphe Funktionen); Konforme Abbildungen (insbesondere Automorphismen der Zahlenkugel); Cauchy’scher Integralsatz, Cauchy’sche Integralformel; Residuensatz mit Anwendungen.
- Trainer/in: Helmut Abels
- Trainer/in: Veronika Ertl
- Trainer/in: Filip Misev
- Trainer/in: Julian Pohl
- Trainer/in: Stefan Stadlöder
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie am vergangenen Mittwoch beim Informationstreffen für die Botanische Großexkursion nach Chile im Oktober 2023 besprochen, möchte ich Ihnen hiermit die Möglichkeit der Anmeldung für eine Teilnahme an der Exkursion einräumen. Bitte tragen Sie sich dazu als Teilnehmer/in in den vorliegenden GRIPS-Kurs ein.
Bevor Sie sich eintragen, möchte ich in Anbetracht der zu erwartenden Überbuchung der Exkursion noch folgende Punkte zu Bedenken geben bzw. auf Kriterien eingehen, nach denen ich eine Teilnahmeberechtigung aussprechen werde. Wie Sie feststellen werden, habe ich dabei versucht, der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es sich in erster Linie um eine wissenschaftliche, botanische Exkursion handelt; die Teilnehmer daher in geeigneter Weise ihr Interesse an der organismischen Botanik dokumentiert haben sollten. Ich werde nach Ende der Anmeldefrist (12.02.2023) in den beiden Interessentengruppen (Lehramt, Master Biologie) getrennt mithilfe der genannten Kriterien ein Ranking erstellen, um eine für alle Beteilgten transparente Entscheidung treffen zu können.
Ein
weiterer Punkt sei noch erwähnt, bevor Sie sich anmelden: Aufgrund der
großen Zahl an Interessenten an einer "Mehrtägigen botanischen
Lehrwanderung" im Lehramtsstudium, werde ich versuchen, auch in diesem
Jahr mindestens eine, wenn nicht zwei dreitägige botanische Exkursionen
in Bayern anzubieten. Da ich diese Exkursionen jedoch ebenfalls aus dem
Exkursionsetat der Fakultät finanzieren muss, werden für die
Großexkursion nach Chile weniger Mittel zur Verfügung stehen als
ursprünglich geplant. Ich denke, dass Sie damit für die Exkursion nach
Chile mit einer Selbstbeteiligung rechnen müssen, die die ursprünglich
kommunizierte Summe von ca. 1500 Euro auf jeden Fall übersteigen wird.
Kriterien für das Ranking
A) Lehramt GYM/RS
- Semesterzahl
- Leistungspunkte in der Biologie (absolut und relativ zur Semesterzahl)
- Leistungspunkte im organismischen Bereich
- Note Pflanzenbestimmungskurs
- Teilnahme an organismisch-botanischen Seminaren (Oberprieler, Poschlod, Reisch)
- Teilnahme an organismisch-botanischen Wahlpflichtkursen/Projektpraktika (Oberprieler, Poschlod, Reisch)
- Mitwirkung als Tutor/in an organismisch-botanischen Praktika (Pflanzenbestimmung, Anatomie und Zytologie der Pflanzen)
B) Master Biologie
- Semesterzahl
- Leistungspunkte in den organismisch-botanischen Schwerpunktmodulen (ESB, BD, ENC, MEE)
- Note Pflanzenbestimmungskurs
- Teilnahme an organismisch-botanischen Seminaren im Bachelor-Studium (Oberprieler, Poschlod, Reisch)
- Teilnahme an organismisch-botanischen Wahlpflichtkursen/Projektpraktika im Bachelor-Studium (Oberprieler, Poschlod, Reisch)
- Bachelorarbeit in der Organismischen Botanik (Oberprieler, Poschlod, Reisch)
- Mitwirkung als Tutor/in an organismisch-botanischen Praktika (Pflanzenbestimmung, Anatomie und Zytologie der Pflanzen)
Bei Gleichstand im Ranking entscheidet das Los!
Bitte verwenden Sie für die Anmeldung zur Exkursion den Einschreibeschlüssel "Chile2023".
- Trainer/in: Christoph Oberprieler
Zeit: Di 14-16
Ort: PT 1.0.4
Dozent: Markus Becker
P-(D-)32045-M03.1, 3 SWS. 8 ECTS
Experimentalpsychologisches Projektseminar
Das Seminar wird in Präsenz abgehalten.
In diesem Kurs werden Fertigkeiten zur Planung und Durchführung einer
empirischen Studie zur Beantwortung einer Fragestellung aus dem Bereich
der visuellen Bewegungswahrnehmung vermittelt. Dabei kommen insbesondere
psychophysikalische Methoden zum Einsatz. Zudem werden Fertigkeiten zur
Auswertung und Kommunikation wissenschaftlicher Befunde in Form eines
Forschungsberichts vermittelt.
- Trainer/in: Markus Becker
Der Expressionismus gilt literarhistorisch als ungemein produktive Bewegung mit zahlreichen intermedialen Bezügen (Bildende Kunst, Kino, Photographie). Charakteristisch für die Epoche ist das Aufgreifen von Psychoanalyse, Nietzsches Kulturkritik, Lebensphilosophie und zahlreichen anderen kulturellen Strömungen im Kampf gegen eine erstarrte überkommene Welt, gegen das selbstgenügsame wilhelminische Bürgertum, gegen die zunehmende Industrialisierung und Mechanisierung des Lebens. Von dieser kurzen, im Kern das „expressionistische Jahrzehnt” (1910-1920) umfassenden Phase, gehen weit reichende Wirkungen auf die spätere Literatur- und Kulturentwicklung bis hinein ins 21. Jahrhundert aus. Die Vorlesung bietet einen Überblick auf die Epoche und ihre zentralen literarischen Vertreter.
- Dozent: Birgit Bockschweiger
Vorab-Informationen zum Sommersemester 2025
Die Einschreibung zum Kurs EUB I wird ab dem 01.04.2025 möglich sein. Bis zum Ende der ersten Vorlesungswoche können Sie sich ohne Passwort einschreiben. Wer sich bis dahin noch nicht eingeschrieben hat, benötigt ab dem 29.04.2025 ein Passwort, welches im Vorlesungsskript zu finden ist und in der ersten Vorlesung kommuniziert wird.
Rechtliche Hinweise zur Nutzung der in diesem GRIPS-Kurs zur Verfügung gestellten Unterlagen
Die Unterlagen zu dieser Lehrveranstaltung werden vollständig oder teilweise digital zur Verfügung gestellt. Mit der Teilnahme an diesem GRIPS-Kurs erklären Sie sich bereit, die nachfolgenden Bedingungen zu akzeptieren:
- Das lokale Speichern, Vervielfältigen, Aufzeichnen oder Teilen der zur Verfügung gestellten Inhalte ist nicht gestattet. Ein Zuwiderhandeln verletzt Urheberrechte des Lehrstuhls bzw. Lehrstuhlinhabers sowie Persönlichkeitsrechte der Lehrpersonen und wird den geltenden Gesetzen entsprechend verfolgt und sanktioniert. Bitte bedenken Sie, dass in diesem Zusammenhang eine eindeutige Identifikation über Ihre NDS-Kennung möglich ist.
- Entsprechendes gilt darüber hinaus für Live-Angebote. Sollten diese zur Verfügung gestellt werden und Sie daran teilnehmen möchten, bestätigen Sie mit Ihrer Teilnahme, dass Ihr Bild und Ihre Stimme mit sämtlichen anderen, der Live-Konferenz zugeschalteten Personen geteilt wird. Soweit Sie dies nicht möchten, können Sie dies verhindern, indem Sie Ihre Kamera sowie Ihr Mikrophon an Ihrem Gerät eigenverantwortlich abschalten. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie zudem Ihr Einverständnis zur Aufzeichnung der Live-Konferenz.
-
Sämtliche online zur Verfügung gestellten Unterlagen zur Lehrveranstaltung dieses GRIPS-Kurses werden unter den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf den entsprechenden Servern der Universität Regensburg verwahrt und nur den im GRIPS-Kurs teilnehmenden Personen verfügbar gemacht.
Darüber hinaus sei auf die allgemeine Datenschutzerklärung von GRIPS verwiesen (https://elearning.uni-regensburg.de/theme/grips_responsive/URPolicy/policy.html). Bei Fragen zur Lehrveranstaltung, dem organisatorischen Ablauf oder inhaltlichen Unklarheiten steht Ihnen der/die Betreuer/-in der Veranstaltung gerne zur Verfügung.
- Trainer/in: Daniel Blab
- Trainer/in: Natalie Dietrich
- Trainer/in: Julia Ertl
- Trainer/in: Axel Haller
- Trainer/in: Alexander Klostermann
- Trainer/in: Cristina Landis
Herzlich Willkommen im GRIPS-Kurs der Fachschaft für Katholische Theologie! Schön, dass du da bist
In diesem Kurs bekommst du wichtige Infos für dein Studium und dein studentisches Leben. Hier kannst du dich mit Kommillitonen austauschen und Fragen stellen. Egal ob du Probleme mit Prüfungen oder dem Semesterstoff hast oder einfach den studentischen Austausch suchst - hier bist du richtig.
Liebe Grüße und alles Gute für dein Studium wünschen dir
Johanna Rüb und Julian Vater
Fachschaftsvorsitzende
- Trainer/in: Fachschaft Katholische-Theologie
Hallo und herzlich willkommen im GRIPS-Kurs der Fachschaft Lehramt. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zu aktuellen Veranstaltungen, unseren Fachschaftssitzungen und vieles mehr.
- Trainer/in: Luisa Felzmann
- Trainer/in: Sebastian Jahn
- Trainer/in: Kiyan Kara
- Trainer/in: Chris Marciniak
- Trainer/in: Dominic Maul
- Trainer/in: Christina Schlegel
- Trainer/in: Sandro Zweck
Während die Beziehung zwischen Zug und Medium von Medienwissenschaftlern wie Wolfgang Schivelbusch sehr gut untersucht wurde, Genres wie das Roadmovie dem Auto eine prominente Rolle in der filmischen Narration geben oder das Auto mit dem Autonomen Fahren in eine neue Medienkultur überführt wird, bleibt dem Fahrrad nur ein mediales Nischendasein: Es scheint als könnten weder Film, Fernsehen oder neue Medien etwas mit dem Fahrrad anfangen, als wäre es in seiner Form zu ungreifbar und als wären die von ihm ermöglichten Bewegungen zu unattraktiv. Das Seminar versucht diese Ansicht in Frage zu stellen und die Medialität des Fahrrads zu untersuchen, als ein Gefährt, das individuelle, freie Bewegungen und eine gleichberechtigte Mensch/Maschinekopplung ermöglicht. Gerade weil das Fahrrad neben dem Gehen die einzige mobile Praxis ist, die keine fossilen und anderen Energien benötigt und anders als das Auto auch nicht auf eine gigantische und problematische Infrastruktur angewiesen ist, sollte eine positive Vorstellung seiner Medialität diskutiert werden, die das Fahrrad in Film und Fernsehen sichtbar werden lässt oder seine Kompatibilität mit einer neuen Medienkultur herausstellt, die sich von narrativen Formen emanzipiert: GoPro-Kameras eignen sich besonders für eine Darstellung der individuellen Bewegungen des Fahrrads, Plattformen wie YouTube lassen neue Formen des Fahrradfilms sichtbar werden. Fahrrad und Medien stellt Fragen hinsichtlich der Repräsentation des Fahrrads und bemüht sich um die Skizzierung einer neuen Mobilitätskultur von Fahrradaktivistinnen und -aktivisten, Blogs, Webseiten, audiovisuellen Plattformen, Dokumentation und vielem mehr. Da es noch wenige Texte zur Fahrradmedialität gibt, versteht sich das Seminar auch als Forschungsprojekt, das die Recherche der Studierende zu einzelnen Aspekten der Fahrradkultur zu einem Gegenstand des Seminars macht.
Anforderungen: Ein großer Teil des Seminars wird über die Lehrplattform Grips organisiert. Es wird eine Mischung aus folgenden Elementen sein, die sich abwechseln werden: Aufgaben, Kommentare und Präsentationen, die auf Grips hochgeladen werden, kurze Zoomsitzungen und Live-Chats. Ein Teil des Seminars werden auch Forschungsaufgaben zur Darstellung des Fahrrads in den Medien sein, die für ein Publikationsprojekt zum Fahrrad von den Studierenden erarbeitet werden sollen (zum Beispiel als Blog zum Seminar). Das Seminar wird mit einer Hausarbeit abgeschlossen.
Angemeldete Student*innen bekommen in der ersten Semesterwoche eine Mail mit dem Passwort für den Gripsordner zum Seminar und einem genauen Fahrplan zum Ablauf des Seminars.
Das Seminar wird mit einer Hausarbeit abgeschlossen.
- Trainer/in: Herbert Schwaab
- Trainer/in: Karin Binder
- Trainer/in: Michael Fricke
- Trainer/in: Jochen Kirchhoff
- Trainer/in: Jochen Kirchhoff
- Trainer/in: Petra Kirchhoff
- Trainer/in: Stefan Krauss
- Trainer/in: Alfred Lindl
- Trainer/in: Madeleine Müller
- Trainer/in: Markus Pissarek
- Trainer/in: Gabriele Puffer
- Trainer/in: Anita Schilcher
- Trainer/in: Anja Schödl
- Trainer/in: Sandra Stadler-Heer
- Trainer/in: Nicole Steib
- Trainer/in: Oliver Tepner
- Trainer/in: Johannes Wild
Dynastien prägten in der Vormoderne das europäische Mächtesystem und dem Haus Habsburg gelang es an der Wende von Mittelalter und Früher Neuzeit, zur einflussreichsten Familie des Kontinents aufzusteigen. Eine strategische Heiratspolitik und militärische Unternehmungen führten neben dynastischen Zufällen dazu, dass die zunächst im Südwesten des Alten Reiches in Erscheinung tretende Dynastie ihren Machtbereich ausdehnte, ihre Vertreterinnen und Vertreter Herrschaftskomplexe in ganz Europa anführten, und – obwohl das Heilige Römische Reich Deutscher Nation keine Erbmonarchie war – seit 1438 für annähernd 400 Jahre (mit einer Ausnahme) seine Kaiser stellten.
Geht der Kurs einerseits ereignisgeschichtlichen Entwicklungen nach, legt er andererseits über die Auseinandersetzung mit innovativen Ansätzen der Dynastiegeschichte offen, dass es sich bei der oft als gegeben wahrgenommenen Kategorie ‚Dynastie als Kollektivsingular‘ um ein kulturelles Konstrukt handelt, an dessen normativen Formierung die agierenden Männer und Frauen sowie die Forschung gleichermaßen beteiligt waren. So fragen wir nach Grenzen vereindeutigender Konzepte von Herrschaft und Familie, um diese als komplexe Phänomene zu untersuchen, die in der Frühen Neuzeit Aushandlungsprozessen und einem Legitimationsdruck unterworfen waren. Aufgrund räumlicher wie zeitlicher Ausdehnung eignet sich das Haus Habsburg in besonderer Weise, um diesen Grundsatzfragen systematisch nachzugehen.

- Trainer/in: Georg Kaulfersch
Dieses Seminar bietet eine Einführung in aktuelle Themen der (kritischen) Spanischdidaktik mit einem Fokus auf Feminismus- und Genderthemen. Neben der Vermittlung von theoretischen Grundlagen erlernen die Studierenden wie sie diese Themen konkret im Spanischunterricht integrieren und thematisieren können. Im Seminar ergänzen sich Theorie (durch Fachlektüre, Praxisbeiträge, etc.) und praktische Übungen (Gruppenaufgaben, Selbstreflexion, Diskussionen, etc.) sinnvoll und bauen aufeinander auf. Verschiedene didaktische und methodische Vorgehensweisen kommen zum Einsatz, um die Inhalte möglichst ansprechend und nachhaltig zu vermitteln. Außerdem reflektieren die Studierenden die Seminarinhalte und beginnen Unterrichtsmaterialien, die feministische und genderbezogene Themen einbeziehen, zu erstellen.
Ziel des Seminars ist es, den Studierenden ein kritisches Verständnis für die Integration und Thematisierung von Feminismus- und Genderthemen im Spanischunterricht zu vermitteln. Die Prüfungsleistung besteht in der Abgabe von schriftlichen Beiträgen, in denen die Studierenden ihre Erkenntnisse und Anwendungen der Seminarinhalte dokumentieren und reflektieren. Grundkenntnisse in Spanischdidaktik durch die Teilnahme am Kurs „Einführung in die Fremdsprachendidaktik“ werden sehr empfohlen, sind aber nicht vorausgesetzt.
- Trainer/in: Svenja Dehler
Die 1970er und 1980er Jahre sind die klassische Ära des Fernsehens. In dieser Zeit bestimmt das Fernsehen fast überall durch seine große Reichweite das nationale Geschehen, erreichen Formate wie Gameshows, Nachrichtensendungen, Magazine oder Fernsehserien ihre gültige Form, etabliert sich eine formale, ästhetische Gestaltung von Programmen, die das Pendant zur Ästhetik des klassischen Hollywoodkinos darstellt. Diese Zeit ist aber auch geprägt von politischen und radikalen Experimenten des Fernsehen von Regisseuren und Autoren wie Dennis Potter oder Rainer Werner Fassbinder oder zeitkritischen Dokumentationen wie den Beiträgen der Stuttgarter Schule, die Freiräume nutzten, die es später nie wieder geben sollte. Zudem zeigen sich bereits in den 1980er Jahren erste Tendenzen zu einer Veränderung des Fernsehens durch das Auftreten neuer, privater Sender, die ihre Zuschauenden mit Formaten wie dem Reality TV oder dem Musikfernsehen auf unmittelbarere Weise ansprechen.
Da es auch die Ära ist, in der sich die ‚klassischen‘ Verfahren der Fernsehwissenschaft etablieren und etwa die Cultural Studies ihre ersten wichtigen Beiträge zu einer Diskussion des Fernsehens machen, wird nicht nur die Sichtung und Analyse klassischer Formate wie Dallas, Columbo, Starsky and Hutch, Miniserien aus den 1980er Jahren wie Roots oder Pennies from Heaven, deutsche Gameshow-Formate wie Dalli Dalli oder Der große Preis, Reality TV Formate wie Aktenzeichen XY ungelöst oder Americas Most Wanted, sondern auch die Lektüre ebenso klassischer Texte der Fernsehwissenschaft von Autor*innen wie Jane Feuer, John Fiske, Horace Newcomb, Knut Hickethier, Ien Ang und Charlotte Brundson Gegenstand des Seminars sein.
Anforderungen und Organisation:
Grundlage des erfolgreichen
Abschlusses des Seminars sind die Übernahme der geforderten Aufgaben und eine
Hausarbeit (ca. 12 Seiten)
Wichtig: Sie werden, wenn sie sich für den Kurs auf Lsf eingetragen haben, ab der ersten Vorlesungwoche, also ab Montag dem 12.April, per Mail das Passwort für das Seminar bekommen. Tragen sie sich dann bitte in den Gripskurs ein, weil sie dann alle weiteren Informationen über das Nachrichtenforum bekommen. Dort finden sie dann auch den Seminarplan und den Zoomlink.
Die erste reguläre Sitzung findet dann in der zweiten Semesterwoche statt.- Trainer/in: Herbert Schwaab
S
Scarcity ist neben availability (1980-2000) und plenty (seit 2000) einer von drei Begriffen, mit denen der Fernsehwissenschaftler John Ellis eine Epocheneinteilung der Fernsehgeschichte anzubieten versucht. Scarcity bezeichnet das relativ knappe und überschaubare Angebot des klassischen, vorwiegend national organisierten Fernsehens in Europa oder des auf wenige Sender konzentrierten kommerziellen Fernsehens der USA in den ersten drei Jahrzehnten der Fernsehgeschichte. Dieser Blick auf den Beginn der Institutionalisierung und der künstlerischen Ausdifferenzierung des Fernsehens bietet die Möglichkeit, der Geburt unterschiedlichster Genres und Formate des Fernsehens wie der Sitcom, der Fernsehshow, den Nachrichten und Magazinsendungen, der Live-Übertragung von Sportereignissen oder des Fernsehkrimis zuzuschauen und mit deren aktuellen Ausformungen in Beziehung zu setzen. So wird das Seminar beispielsweise versuchen, einen Bogen zu schlagen von den ersten Soap Operas der 1950er Jahre bis zu den Prime Time Soaps wie Dallas oder Dynasty in den späten 1970er Jahren und so einen Einblick in die Geschichte der Formatentwicklung zu bieten. Ebenso soll auf vergessene Genres aufmerksam gemacht werden wie etwa die in den 1950er Jahren äußerst erfolgreichen und künstlerisch überaus ambitionierten Live-Dramen. Das Seminar wird sich aber auch damit beschäftigen, wie das Fernsehen eine Rolle für die Konstitution von Nation und Gemeinschaft übernommen und die Gesellschaft verändert hat, wie die häusliche Rezeption das Zusammenleben der Familie neu geordnet und welche anderen Orte und Formen der Rezeption des Fernsehens es gegeben hat. Ebenso soll thematisiert werden, wie ökonomische Aspekte bereits in der Frühzeit des Fernsehens der USA eng mit seinen Sendeformen verbunden waren. Neben der Diskussion von fernsehgeschichtlichen Beiträgen wird auch die Sichtung von Formaten des frühen Fernsehens Teil des Seminars sein.
Grundlage der erfolgreichen Teilnahme am Seminar sind Referat, Hausarbeit (Abgabe am 30.9.2023) und die regelmäßige Beteiligung an der Seminardiskussion.
- erstellt von : Herbert Schwaab
Ein Blick in den Duden genügt, um die thematischen Grundrisse dieses Seminars kennen zu lernen. Denn was ist Adaption bzw. Adaptation? 1. (Biol.) Anpassung des Organismus, von Organen an die jeweiligen Umweltbedingungen. 2. (Soziol.) Anpassung des Menschen an die soziale Umwelt: die A. des Menschen an seinen Lebensraum. 3. Umarbeitung eines literarischen Werkes mit der Absicht, es den Erfordernissen einer anderen literarischen Gattung od. eines anderen Kommunikationsmediums (z. B. Film, Fernsehen) anzupassen. In dieser Definition erkennen wir die Adaption als Lebensnotwendigkeit, sowohl in biologischer als auch in soziologischer und künstlerischer Hinsicht, doch ebenso die Gefahr, das Adaptierte, die Mutation könnte die ursprüngliche Identität verlieren. Den Kursschwerpunkt bildet vor allem die Analyse und Besprechung der Theorien filmischer Adaption literarischer Werke, wobei auch Exkurse in andere Medien denkbar sind. Dabei wird versucht, einen Weg zwischen absoluter Befreiung der Adaptation und sklavischer Treue zu finden, um gerade die notwendigen Mutationen neben neuen Interpretationen zu beleuchten. Unabdingbar für diese Vorgehensweise ist eine sorgfältige Lektüre und Analyse von den Ausgangstexten, einer breiten Palette von Texten, die zu unterschiedlichen Gattungen gehören und aus mehreren slavischen Kulturen stammen (B. Hrabals Obsluhoval jsem anglického krále, K.J. Erbens Kytice, K.H. Máchas Máj, M. Gorkijs Mat`, S. Lems Solaris, u.a.). Medientheoretische Texte werden im Laufe des Kurses herangezogen werden, um einen Überblick über die Problematik zwischen Film und Literatur zu geben und Teilnehmer mit auf den Stand der Forschung zu bringen. Neben aktiver Mitarbeit sind drei Essays (oder ein Kurzfilm) und eine Klausur für den Schweinerwerb nötig.
- Trainer/in: Kenneth Hanshew
Das Seminar beschäftigt sich mit einem der faszinierendsten Themen der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts, nämlich dem Verhältnis von Alter und Neuer Musik bzw. der Rezeption älterer, d.h. im weitesten Sinn vorklassischer Musik, in der Moderne und durch die Avantgarde nach 1918. Im Zentrum sollen ästhetische und technische Herangehensweisen von Komponisten des 20. Jahrhunderts im Umgang mit Alter Musik stehen, die durch die Auseinandersetzung mit Kompositionsverfahren des Mittelalters, der Renaissance und des Barock ihre eigene musikalische Sprache zugleich überprüft und weiterentwickelt haben. Die Auseinandersetzung mit Alter Musik hat quer zu allen stilistischen und ideologischen Divergenzen stattgefunden. Im Seminar werden Werke unter anderem von Schönberg, Webern, Stravinsky, Webern, Hindemith, Nancarrow, Ligeti, Nono, Sciarrino, Crumb und Goeyvaerts besprochen; die genaue Werkauswahl wird in der ersten Sitzung festgelegt.
- Trainer/in: Katelijne Schiltz
Kommentar: Forschend-entdeckendes Lernen ist ein gewinnbringender Ansatz im Geschichtsunterricht – dies gilt aus allgemein motivationeller wie auch aus fachdidaktischer Sicht. Das Erkennen, Analysieren und Deuten von historischen Quellen im außerschulischen Raum ist eine zentrale Kompetenz einer geschichtsbewussten Person. Deshalb ist es auch in der Mittelschule unumgänglich, forschenden und (selbst-)entdeckenden Unterricht zu konzeptionieren. Hierbei ist es jedoch wichtig, die Lernenden nicht durch zu viele verschiedene Impulse zu überfordern, sondern die Schülerinnen und Schüler angeleitet auf den Weg des Forschens zu führen. Dies gelingt durch anleitende Forscherhefte. Im Kurs beschäftigen wir uns mit: - dem fachdidaktischen Prinzip des forschend-entdeckenden Lernens - Quellenarten, die in der Mittelschule besonders gut nutzbar sind - Lehrplanthemen, die für den Einsatz von Forscherheften geeignet sind - dem Aufbau von Forscherheften - der Produktion eines Forscherhefts inkl. Erwartungshorizont - Herausforderungen (Scaffolding, Bewertung) |
Dieser Kurs setzt seinen Schwerpunkt auf den Geschichtsunterricht in der Mittelschule. Eine Teilnahme Studierender anderer Schularten ist grundsätzlich möglich, der Leistungsnachweis ist allerdings für die Zielgruppe Mittelschüler*innen zu erbringen. Vorraussetzungen: Wenn die Übung für Basismodule GES-LA-M20, GES-LA-M22, GES-LA-M23 zählen soll, muss der Grundkurs Fachdidaktik abgeschlossen sein. Wenn die Übung für das Aufbaumodul GES-LA-M21 zählen soll, muss das Basismodul GES-LA-M20 abgeschlossen sein. Leistungsnachweis: Aktive Mitarbeit, Entwurf eines Forscherhefts mit Erwartungshorizont, didaktische Reflexion der Gestaltung des Forscherhefts |
- Trainer/in: Julius Arnold
- Trainer/in: Laura Dietl
- Trainer/in: Christine Grieb
- Trainer/in: Constantin Leitner
„Der Dammbruch ist bereits eingetreten und nicht mehr aufzuhalten. Der digitale Markt ist doch da“ verteidigte der Vorstandvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württembergs, Norbert Metke, 2018 im Deutschen Ärzteblatteine wichtige Veränderung in der deutschen Berufsordnung für Mediziner. Das Verbot der Fernbehandlung wurde gelockert und damit der Weg frei gemacht für die Telemedizin in Deutschland, also die Diagnose und Behandlung von Patienten, die sich an einem anderen Ort befinden als der behandelnde Arzt. Die Idee dahinter ist nicht neu – Seuchenfeuer, Pestglocken und Notrufsäulen sind Instrumente in der Geschichte einer über 2000 Jahre alten Fernmedizin. Besonders mit dem Aufkommen elektrischer und elektronischer Kommunikationsmittel ab dem 19. Jahrhundert wird die Telemedizin jedoch von sich verändernden Berufsfeldern, spannenden Visionen, aber auch großen Ängsten begleitet. Ihre Einsatzgebiete reichen vom Arzt nebenan bis zu den Polen, Tropen oder gar bis ins Weltall. Wie lässt sich dieses komplexe Feld medienwissenschaftlich skizzieren? Wer sind Akteure, welche Geräte, Netzwerke und Machtstrukturen spielen eine Rolle? Das Seminar versucht sich diesen Fragen zu nähern, indem die Geschichte, Forschungsrichtungen und Entwicklungen der Telemedizin in mehreren Blocksitzungen diskutiert werden. Es handelt sich um ein Forschungsseminar, dessen ausdrückliches Ziel es ist eine Forschungswebseite zur Telemedizin einzurichten.
- Trainer/in: Laura Niebling
Das Ziel des Forschungskolloquiums ist es, mit den Teilnehmern/innen interessante Themen und vor allem interessante begrenzte Forschungsfragen im Bereich der AVS zu entwickeln, die zum Thema der Bachelorarbeit führen können (aber nicht müssen). Folgende Komponenten eines begrenzten Forschungsprojektes sollen jeweils einzeln mit den Teilnehmern im Seminar diskutiert werden. Bei der Diskussion der folgenden Komponenten muss immer der Umfang einer BA (mindestens 30 und höchstens 50 Seiten) bzw. MA Arbeit (höchstens 80 Seiten) im Blick bleiben.
- Trainer/in: Johannes Helmbrecht
|
Aufbauend auf den Grundlagen des Information Retrieval Kurs werden hier Kompetenzen in der Anwendung von Methoden in folgenden Bereichen des Information-Retrievals vermittelt:
Zur Wissensvertiefung im gewählten Teilgebiet gehört die Vermittlung
Nach erfolgreicher Beendigung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage im gewählten Teilbereich
|
- Trainer/in: David Elsweiler
| Kommentar |
In diesem Seminar präsentieren Angehörige des Lehrstuhls, fortgeschrittene Studierende und Doktoranden ihre laufenden Projekte zum Thema Zeitmanagement. Darüber hinaus werden Arbeitsaufträge aus der Feldforschung zusammengetragen, mittels qualitativer Datenanalyse (MAXQDA) ausgewertet und auf die Zielgruppen fokussiert. – Das Seminar ist grundsätzlich auch für Studierende geeignet, die ihre Zulassungsarbeit (ZULA) zum musikbezogenen Zeitmanagement und zur Zeitwahrnehmung in musikalischen Prozessen vorbereiten. Teilnahme auf Anfrage. |
|---|---|
| Literatur |
Rolf Kramer (2000). Phänomen Zeit. Versuch einer wissenschaftlichen und ethischen Bilanz. Berlin: Duncker & Humblot. – Karlheinz A. Geißler und Jonas Geißler (2018, 2. Aufl.). Time is honey. Vom klugen Umgang mit der Zeit. München: oekom. |
- Trainer/in: Magnus Gaul
Das Seminar umfasst drei Komponenten:
a) Coaching-Angebot
b) Seminarteil mit Vorträgen zu aktuellen Forschungsfeldern der Medieninformatik
c) Projektteil: Durchführung einer Studie oder eines Entwicklungsprojektes
Zu a)
Für Masterstudenten ab dem dritten Semester wird ein individuelles Coaching angeboten, in dem die Studierenden auf die bevorstehende Masterarbeitet vorbereitet werden sollen, Das Coach dient dem Identifizieren geeigneter Themenfelder für die Masterarbeit ebenso wie dem Review bisher gewählter Schwerpunkte im Studium.
Zu b)
Zur Seminarbeginn steht eine Themenleiste zur Verfügung, die einerseits aktuelle Forschungsthemen der Medieninformatik zur Diskussion stellt. Ziel des Seminar ist es, den jeweils aktuellen Forschungsstand in der Medieninformatik und verwandten Feldern zu erfassen und zu diskutieren. Entsprechende Themen ergeben sich aus einer Sichtung der aktuellen Jahrgänge einschlägiger Tagungen (CHI, EICS, UIST, IST, Mensch & Computer, GUPA etc.) und Zeitschriften (ACM interactions, ACM Multimedia, i-com etc.). Weitere Themen werden aus den aktuellen Forschungsschwerpunkten der Medieninformatik in Regensburg (vgl. dazu die entsprechenden Publikationen, die Schwerpunkte des Forschungsseminars MMI im Bachelor Medieninformatik und der Mastermodule MEI-M 30-32 und INF-M 34) und ggf. auch den individuellen Interessen der Seminarteilnehmer gewonnen. Der Seminarteil ist dabei eng mit dem Seminar Wissenschaftliche Methodik und Praxis verbunden.
Zu c)
Der Projektteil des Seminars umfasst die Planung, Durchführung, Präsentation und Dokumentation (Forschungsbericht) einer Studie aus dem Bereich der in b) vorgestellten Forschungsfelder. Der Forschungsbericht, der abschließend zu erstellen ist, vereint dabei sowohl die Darstellung des Umfeldes (state-of-the-art, Literaturbericht) als auch die Dokumentation der Studie selbst.
- Dozent: Patricia Böhm
- Dozent: Tim Schneidermeier
- Dozent: Christian Wolff
Content of FKS'22
- Functional characteristics of communication systems
- Principles of Communication (Principles, physical layers, models, safety & security aspects in communication)
- Different communications media/approaches in electronics
- Software based communication in machines
- Non-functional aspect
- Timing characteristics and analysis methods in communication systems
- Practice of Communication systems
- Communication protocols in vehicles (e.g. CAN, Ethernet)
- Communication in AUTOSAR Control Units
- Safety in Vehicle Communication
- Security in Vehicle Communication
- Gateways in Vehicle Communication
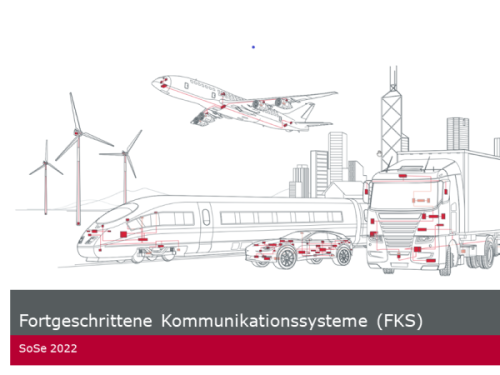
- Trainer/in: Michael Deubzer
- Trainer/in: Arlinda Elmazi
- Trainer/in: Tobias Jennewein
Guten Morgen,
wie Ihnen sicher Herr Tepner mitgeteilt hat, würde ich Sie gerne bei der Staatsexamensvorbreitung in PC unterstützen.
Dazu biete ich am 8. August eine Fragestunde von 10:00 -12:00 an.
Uns liegt sehr viel an einer soliden Ausbildung unserer Lehrer.
Viele Fragen im Staatsexamen bewegen sich auf dem Niveau einer allgemeinen Chemie Vorlesung im Nebenfach.
Ich habe schon einige Semester die Vorlesung Chemie für Physiker gehalten und dazu auch wertvolle Video Ressourcen geschaffen.
Einige Themen wären sicher für das Staatsexamen eine gute Vorbereitung.
Sie finden diese im beiliegenden Skript mit Links. In der Kombination Mozilla Firefox (standardbrowser) und Adobe Acrobat funktionieren die Links werbefrei
Beste Grüße Hubert Motschmann
- Trainer/in: Hubert Motschmann
Herzlich Willkommen im Moodlekurs zu den Sonnenkönigen
Hier erfährst du einiges zu den Sonnenkönigen und ihr Leben.
Du bekommst selbst die Möglichkeit in die Rolle eines Sonnenkönigs zu schlüpfen
und seine Vor- und Nachteile kennen zu lernen.
- Trainer/in: Christoph schroeder
Als Reaktion auf den Livländischen Krieg, das Terrorregime unter Ivan IV. und die große Wüstungsperiode schränkte das Moskauer Reich Ende des 16. Jahrhunderts das Recht der Bauern auf freien Abzug erstmalig ein. Das Gesetzbuch von 1649 band die Bauern dann lebenslänglich an den Grundherrn. Damit hatte sich die ursprünglich als Notmaßnahme gedachte Aufhebung der Freizügigkeit zu einer generellen Bindung an die Scholle verfestigt.
Die Vorlesung beleuchtet zunächst die Motive des Staates, der mit der Einführung der Leibeigenschaft die Militärdienstfähigkeit des Adels und ein verlässliches Steueraufkommen sicherstellen wollte. In einem zweiten Schritt wird untersucht, wie die Bauern auf die Einführung der Leibeigenschaft reagierten. Wir schauen insbesondere auf das Läuflingswesen und die Aufstände, die das Moskauer Reich im 17. und 18. Jahrhundert erschütterten. In einem dritten Schritt betrachten wir die gemeinsamen Lebenswelten der Leibeigenen und Gutsadligen. Hierfür nehmen wir eine vergleichende Perspektive ein und fragen, inwieweit sich die Leibeigenschaft in Russland von anderen Formen unfreier Arbeit, z.B. der Leibeigenschaft in anderen europäischen Ländern sowie der Sklaverei in den USA unterschied. Abschließend untersuchen wir, aus welchen Gründen die Leibeigenschaft im 18. Jahrhundert zunehmend in die Kritik geriet und warum es trotzdem erst 1861 zur Bauernbefreiung kam.
In response to the Livonian War, the reign of terror under Ivan IV and the great period of desolation, the Moscow Empire restricted the peasants' right to free exodus for the first time at the end of the 16th century. The Code of 1649 then bound the peasants to the landlord for life. This meant that the abolition of freedom of movement, originally conceived as an emergency measure, had solidified into serfdom.
The lecture first examines the motives of the state, which wanted to ensure the military serviceability of the nobility and a reliable tax revenue by introducing serfdom. In a second step, we will examine how the peasants reacted to the introduction of serfdom. In particular, we look at the uprisings that shook the Muscovy in the 17th and 18th centuries. In a third step, we look at the common worlds of the serfs and the nobles. For this, we take a comparative perspective and ask to what extent serfdom in Russia differed from other forms of unfree labour, e.g. serfdom in other European countries as well as slavery in the USA. Finally, we examine the reasons why serfdom came under increasing criticism in the 18th century and why, despite this, peasant liberation did not occur until 1861.
Literatur:
Peter Kolchin, UnfreeL. American Slavery and Russian Serfdom, Cambridge, Mass. 1987; David Moon, The Abolition of Serfdom in Russia, 1762 - 1907 (= Seminar Studies in History), Harlow 2001; Christoph Schmidt, Sozialkontrolle in Moskau. Justiz, Kriminalität und Leibeigenschaft 1649 - 1785. Zugl.: Köln, Univ., Habil.-Schr., 1993-94 (= Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa, Bd. 44), Stuttgart 1996; Elise Kimerling Wirtschafter, Russia's Age of Serfdom 1649 - 1861 (= The Blackwell history of Russia), Malden, Mass. u.a. 2008.
Leistungsnachweis: Klausur
- Trainer/in: Julia Herzberg
- Trainer/in: Wolfgang Hoessl
- Trainer/in: Juergen Schoentag
- Trainer/in: Ingrid Seidl
- Trainer/in: Matthias Bammler
- Trainer/in: Ingrid Seidl
Willkommen auf der GRIPS-Seite zur Vorlesung Funktionalanalysis im Wintersemester 2022/23
Auf dieser Seite finden sie Informationen zur Vorlesung und zum Übungsbetrieb. Außerdem wird hier jede Woche das aktuelle Übungsblatt zu finden sein.
Dozent: Prof. Felix Finster
(Email: Felix.Finster@mathematik.uni-regensburg.de //
Sprechstunde: Dienstag, 13:30 - 14:15 Uhr, M 225)
Assistenten: C. Paganini (Email: claudio.paga@gmail.com)
Übungsgruppen: M. Lottner
Vorlesung: Di, Mi 10:15-11:45 im M101
Information zum Übungsbetrieb:
Es wird zwei Übungsgruppen geben. Die Einteilung in die Übungsgruppen findet in der ersten Vorlesung statt. Die Übungen beginnen in der zweiten Vorlesungswoche.
| Gruppe | Zeit | Ort | Übungsleiter | Kasten |
| Gruppe 1 | Mo, 12-14 Uhr | M103 | ||
| Gruppe 2 | Mi, 14-16 Uhr | Phy 9.1.09 |
Jeden Freitag wird auf dieser Seite das neue Übungsblatt zur Verfügung gestellt. Sie haben dann bis Donnerstag 12 Uhr der nachfolgenden Woche Zeit, das Blatt zu bearbeiten und im Kasten ihrer Übungsgruppe einzuwerfen.
Information zur Klausur:
Eine erfolgreiche Teilnahme an den Übungen der Veranstaltung ist Voraussetzung zur Zulassung zur Prüfung. Ein benoteter Leistungsnachweis kann ausgestellt werden. Die Prüfungen finden während der ersten beiden Wochen nach Ende der Vorlesungszeit statt, die Wiederholungsklausur gegen Ende der Semesterferien. Genaue Termine werden noch bekanntgegeben.
Literatur: Wird in Vorlesung angekündigt.
- Trainer/in: Felix Finster
- Trainer/in: Claudio Paganini
Der Ausbau der Ganztagsschulen ist in Deutschland ein sozioökonomisches und zugleich pädagogisches Anliegen. Zudem erhofft man sich strukturelle Veränderungen der Grundschule mit positiven Auswirkungen auf Unterrichtsgeschehen oder Lernumgebung. Der Zuwachs an Zeit und Raum der Ganztagsschulen soll insbesondere schwachen Schülern und solchen aus einem bildungsfernen Elternhaus zugute kommen.
Im Seminar werden Begründungen, Zielsetzungen und die verschiedenen Modelle des Ganztagsbetriebs in Hinblick auf die Bedingungen der Möglichkeit pädagogisch und didaktisch angemessen zu handeln, beleuchtet. Reflektiert und einer kritischen Betrachtung unterzogen werden auch reformpädagogische Vorläufer der Ganztagsschulen sowie Ganztagsmodelle in anderen Bundesländern (etwa die Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg) und Ganztagsschulentwicklungen im internationalen Vergleich.
An einem Freitag im November oder Dezember soll eine mehrstündige Exkursion an eine Ganztagsschule stattfinden. Details werden im Seminar besprochen.
- Trainer/in: Angela Enders
Jede(r) vierte Deutsche hat mindestens einen Großelternteil deutscher Muttersprache, der im östlichen Europa geboren worden war und nach dem zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland eine neue Heimat finden musste. In Bayern sind es noch mehr. Das deutsche Sprachgebiet grenzt seit über 1000 Jahren nach Osten u.a. am polnischen, tschechischen, später slowakischen, ungarischen und karantanisch-slowenischen. Seit über 800 Jahren leben deutsche Volksgruppen außerhalb des deutschen Sprachgebiets im östlichen Europa: u.a. im Baltikum, dem ehemaligen Oberungarn (heute Slowakei) in Siebenbürgen (heute Rumänien) und später seit etwa 300 Jahren hauptsächlich im ungarischen Transdanubien aber auch im heutigen Süd- und Nordwestrumänien bzw. verschiedenen Gebieten des heutigen Russlands und Weißrusslands und der Ukraine. In all diesen Ländern bildeten BürgerInnen deutscher Sprache je nachdem bis Anfang des 19. und bis Anfang des 20. in Städten die Mehrheit oder zumindest eine einflussreiche Schicht. Deutsch war hier neben oder bald nach dem Lateinischen nicht nur eine Verkehrssprache, was die örtlichen Kulturen nachhaltig prägte, sondern wurde seit über 300 Jahren in unterschiedlichen Formen systematisch als Mutter und Fremdsprache gelernt und unterrichtet. Die bis vor kurzem geltende Unterscheidung zwischen DaM, DaZ und DaF war wegen des oben geschilderten historischen Hintergrundes im östlichen Europa immer problematisch. Sie hatte zwischen der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg und der Jahrtausendwende eine gewisse Berechtigung, die angesichts der neuen Mobilität seit den letzten beiden Jahrzehnten erneut nicht bestehen kann.
Das Ziel der Lehrveranstaltung ist es, über die sprachlichen Grundlagen für den Kulturtransfer über das Deutsche bzw. die grundlegende Mechanismen der Sprachkontakte mit Deutsch im östlichen Europa einen Überblick zu verschaffen, wobei nach persönlichem Interesse der TeilnehmerInnen einigen ausgewählten Gebieten mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Darauf aufbauend werden nicht nur die Deutschlern- und lehrtraditionen wiederum zum Teil spezifisch untersucht, sondern die Stellung des Deutschen in der jüngsten Vergangenheit bzw. Gegenwart in den einzelnen Zielgebieten analysiert.
Der Fokus der Lehrveranstaltung liegt auf dem Unterricht. Referatsthemen werden hauptsächlich zu diesem Bereich vergeben. Immerhin gibt es einige wenige Referatsthemen aus dem historisch-sprachenpolitischen Bereich.
|
Weiterführende Literatur zu den einzelnen Regionen/Ländern: Glück, Helmut: Die Fremdsprache Deutsch im Zeitalter der Aufklärung, der Klassik und der Romantik. Wiesbaden, 2013, S. 235-352, 535-674 (Bibliographie). – HSK (Handbücher zu Sprach- und Kommunikationswissenschaft) Bd. 12.2 Kontaktlinguistik, Berlin 1997 (eBook 2008), S. 1407-1501, 1583-1933. – HSK Bd. 19.2 Deutsch als Fremdsprache, Berlin 2001, S. 1424-1690. – HSK Bd. 35.2 Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Berlin 2010, S. 1602-1842.; Ammon, Ulrich: Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt. De Gruyter. Berlin/München/Boston, 2015, S. 320-358, 1008-1017, Eichinger, Ludwig M. et al (Hrsg.), Handbuch der deutschen Sprachminderheiten in Mittel- und Osteuropa, Gunter Narr, Tübingen, 2008, Gester, Silke/Kegyes, Erika (Hrsg.), Quo vadis, DaF? II. Betrachtungen zu Deutsch als Fremdsprache in den Ländern der Visgrád-Gruppe, Peter Lang, Frankfurt a.M., 2015 |
|
- Trainer/in: Akos Bitter
"Der Dammbruch ist bereits eingetreten und nicht mehr aufzuhalten. Der digitale Markt ist doch da” verteidigte der Vorstandvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württembergs, Norbert Metke, 2018 im Deutschen Ärzteblatt eine wichtige Veränderung in der deutschen Berufsordnung für Mediziner. Das Verbot der Fernbehandlung wurde gelockert und damit der Weg frei gemacht für die Telemedizin in Deutschland, also die Diagnose und Behandlung von Patienten, die sich an einem anderen Ort befinden als der behandelnde Arzt. Doch der digitale Markt der Medizin ist noch erheblich umfassender – vom Operationsroboter, über die digitale Bilddiagnostik bis hin zur elektronischen Patient*innen-Akte finden sich an vielen Stellen Bausteine einer digitalen Medizin in der heutigen Gesundheitsversorgung. Das Seminar widmet sich dem Komplex der digitalen Medizin in Deutschland und fragt: welche Rolle spielen Medien in der modernen Medizin? Woher kommen heutige digitale Technologien, die dokumentieren, vernetzen und mitunter bereits diagnostizieren? Und was bedeutet ‚digitale Medizin‘ eigentlich – für die Medienwissenschaft, das Gesundheitswesen und die Patient*innenschaft? Das Seminar nähert sich diesen Fragen über einige grundlegende Bausteine deutscher Medizinmedien im Prozess ihrer Digitalisierung. Es soll hierbei zum einen Kenntnisse in einer medienhistorischen Analyse von Technologien und zum anderen Grundlagenwissen zu medizinischen Medien und deren Funktionsweisen vermitteln.

- Trainer/in: Laura Niebling
Das Seminar analysiert zentrale Aspekte und Entwicklungsstränge der
Geschichte der Juden im Raum des heutigen Bayern in einer langen
historischen Perspektive vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Zur
Sprache kommen die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und
politischen Kulturen in den einzelnen eigenständigen traditionellen
Herrschafts- und Lebensräumen (Franken, Altbayern, Hochstifter,
Stadt-Land) ebenso wie die verschiedenen Phasen und Gründe von Konflikt,
Ausgrenzung und Verfolgung (Vertreibung, Ghettoisierung) wie Annäherung
und Austausch (kulturelle und ökonomische Einflüsse, Aufklärung), die
Formen von Selbstbehauptung und Emanzipation, die Fragen und Probleme
von Assimilation und Akkulturation, ferner die Traditionen und
Ausprägungen von Ressentiments und Antisemitismus (bis hin zur
Eliminierung), zuletzt die Fragen der Wiedergutmachung und des
Neuanfangs jüdischen Lebens in Bayern nach 1945.
- Trainer/in: Christoph Kaindl
- Trainer/in: Bernhard Löffler
- Trainer/in: Michaela Stauber
Die Seminaraufgabe besteht im Verfassen von zwei Artikeln für den Blog "Forschungslabor Telemedizin", die in Gruppenarbeit verfasst werden können. Als abschließende Prüfungsleistung ist bis 30.9.2020 eine Hausarbeit zu schreiben (BA: 25.000, MA: 40.000 Zeichen). Die Themenabsprachen erfolgen im Laufe des Semesters.
Die Telemedizin, also die Diagnose und Behandlung von Patienten, die sich an einem anderen Ort befinden als der behandelnde Arzt, beginnt zunehmend die medizinische Landschaft Deutschlands und Bayerns zu verändern. Die Idee dahinter ist nicht neu – Seuchenfeuer, Pestglocken und Notrufsäulen sind Instrumente in der Geschichte einer über 2000 Jahre alten Fernmedizin. Besonders mit dem Aufkommen elektrischer und elektronischer Kommunikationsmittel ab dem 19. Jahrhundert, und insbesondere im Rahmen der Telematikinfrastrukturen ab den 1990er-Jahren, wird die Telemedizin jedoch von sich verändernden Berufsfeldern, spannenden Visionen, aber auch großen Ängsten begleitet. Ihre Einsatzgebiete reichen vom Arzt nebenan bis zu den Polen, Tropen oder gar bis ins Weltall. Wie lässt sich dieses komplexe Feld medienhistorisch aufarbeiten?
- Trainer/in: Laura Niebling
Mit dem Einzug des Tonfilms veränderte sich nicht nur Hollywood, sondern die gesamte Geschichte des Films nachhaltig. Doch Film war niemals gänzlich stumm – atmosphärische Pianobegleitung, romantische Musicalnummern, laute Rocksoundtracks: Film war und ist geprägt von Musik. Und Musik ist eines seiner erfolgreichsten Sujets. Das Seminar diskutiert einige der berühmtesten Beispiele der Musikfilmgeschichte und spannt dabei einen historischen Bogen. Diskutiert werden Beispiele von frühen Aufzeichnungen des französischen Vaudevilles über den berühmten "ersten Tonfilm" 'The Jazz Singer' (1927), epische Festivaldokumentationen wie 'Woodstock – 3 Days Of Peace And Music' (1970) bis zum aktuellen Weltkino auf Streamingplattformen – wie dem japanische Experimentalfilm 'Adam By Eve: A Live in Animation' (2022) oder der türkische Komödie 'Gönül – Herzenslied' (2022). Technisch und medientheoretisch umfasst das Seminar hierbei die wichtigsten Entwicklungen vom Stummfilm bis zu VR/AR-Konzertfilmen.
Die filmische Darstellung von Musik wird unter anderem aus technischen, ästhetischen und ökonomischen Perspektiven beleuchtet. Das Seminar vermittelt dabei auch eine Einführung in die verschiedenen Zugänge, mit denen Filmgeschichte geschrieben werden kann.
- Trainer/in: Laura Niebling
|
Dieses Proseminar bietet einen Überblick über die Geschichte Kosovos vom Zweiten Weltkrieg bis zur Unabhängigkeitserklärung im Jahr 2008. Die junge Republik kann sich nicht auf eine lange staatliche Tradition stützen und existiert als administrative Einheit in ihren heutigen Grenzen erst seit dem Zweiten Weltkrieg. Das Proseminar wird die Geschichte Kosovos in die Herrschafts- und Zerfallsgeschichte des sozialistischen Jugoslawiens einbetten und seine zentralbalkanische Traditionen und Bezugspunkte berücksichtigen. Es wird die Geschichte Kosovos nicht auf eine ethnonationale Konfliktgeschichte verengen. Daher sollen neben (ethno-)politischen auch sozioökonomische und soziokulturelle Entwicklungen und Ausdifferenzierungsprozesse betrachtet werden. Es kommen historisch-anthropologische, alltagsgeschichtliche und sozialgeschichtliche Perspektiven und Methoden zur Anwendung. Das Proseminar verlangt regelmäßige Lektüre, die einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum (post-)sozialistischen Kosovo vermitteln soll. |
- Trainer/in: Friederike Kind-Kovács
- Trainer/in: Isabel Ströhle
Dieses Seminar wird die Geschichte der Sitcom von seiner Erfindung im US-Fernsehen der 1950er Jahre mit Sendungen wie I Love Lucy bis zu aktuellen Sitcoms wie Big Bang Theory nachzeichnen. Das auf den ersten Blick ästhetisch ‚armselig‘ und gewöhnlich wirkende Genre der Sitcom erweist sich dabei als eine Form mit einer komplexen Geschichte, die auf hintergründige Weise seinen Stil verändert und auf intensive Weise mit Kultur und Gesellschaft interagiert. Die Sitcom liefert als exemplarisches Fernsehgenre Einblick in das Wesen von Fernsehen als Unterhaltungsmedium. Die Lektüre kultur- und medienwissenschaftlicher Texte zu dem Genre sowie die Analyse einzelner Szenen wichtiger Sitcoms soll zu einer Auseinandersetzung mit audiovisuellen Erzählformen und ihrer Rezeption führen. Dabei wird auch erkundet, wie die Sitcom das Medium des Fernsehens, seine Zuschauer und unsere Beziehung zur Welt erkundet und wie sie mit innovativen Formen wie The Office bis heute die Fernsehästhetik weiterentwickelt. Exemplarische Folgen klassischer und neuerer Sitcoms werden im Seminar gesichtet.
Zur Einführung empfohlen: Herbert Schwaab, „Dancing King of Queens“ im online-Magazin Kultur und Geschlecht # 4 (2009).
Grundlage des Scheinerwerbs sind Referat und Hausarbeit.
- Trainer/in: Herbert Schwaab
Das Seminar versucht in Screenings, Analysen und Textdiskussionen das Filmmusical vor allem als genuin filmische Form zu erkunden, die nicht nur eine harmonische Zusammenführung von Tanz, Musik, Gesang und Schauspiel sucht, sondern sich auch auf wesentliche Aspekte der filmischen Form bezieht: Bewegung, Farbe, Rhythmus, Bildkomposition und vor allem die unterschiedlichen Möglichkeiten, Übergänge zwischen Realität und Fantasie zu inszenieren. Aus diesem Grund ist die Auseinandersetzung mit dem Filmmusical auch eine Erkundung der grundlegenden Elemente des populären Kinos. Wichtigster Bezugspunkt des Seminars ist das klassische Filmmusical der 1930er bis 1950er Jahre mit seinen wichtigsten Akteuren und Regisseuren wie Vincente Minelli, Busby Berkeley, Fred Astaire, Judy Garland oder Gene Kelly. Es wird sich aber auch dem Niedergang des Genres in den 1960er Jahren, den weiteren Entwicklungen zum Spätmusical (Cabaret) oder der Rockoper (Tommy) widmen. Nicht nur die unzähligen Musicalmomenten in unterschiedlichen Filmen des aktuellen Kinos (Inland Empire oder La La Land) oder Fernsehens (Glee oder die Musicalepisode von Transparent) verweisen auf die Aktualität des Genres, sondern auch die vielen Versuche von Regisseur*innen wie Godard, Demy, Vardas, Resnais oder von Trier in Hommagen auf das Genre Bezug zu nehmen oder das Genre zu erneuern und zu erkunden. Letztendlich geht es auch um eine medienphilosophische Erkundung eines populären Genres, das uns, wie Richard Dyer es einst beschrieben hat, nicht sagen kann, wie die Utopie aussieht, aber auf der sinnlichen Ebene vermitteln kann, wie es sich anfühlt, in einer besseren Welt ‚irgendwo hinter dem Regenbogen‘ zu leben.
Anforderung und Organisation:
Ein großer Teil des Seminars wird über die Lehrplattform Grips organisiert. Es wird eine Mischung aus folgenden Elementen sein, die sich abwechseln werden: Aufgaben, Kommentare und Präsentationen, die in Foren zu den jeweiligen Sitzungen eigenständig auf Grips hochgeladen werden, und Zoomsitzungen, in denen ihre Beiträge diskutiert werden sollen und Impulse für die Seminarthemen gegeben werden. Die Filme werden über links auf Grips zugänglich gemacht. Eine Sammlung von Texten zum Musical werden sie ebenfalls auf Grips finden.
Grundlage des erfolgreichen
Abschlusses des Seminars sind die Übernahme von 2 Aufgaben (Analysen,
Präsentationen oder Kommentare) und das Verfassen einer Hausarbeit (16-18
Seiten im Bachelor und 18-20 Seiten im Master)
Wichtig: Sie werden, wenn sie sich für den Kurs auf Lsf eingetragen haben, ab der ersten Vorlesungwoche, also ab Montag dem 12. April, per Mail das Passwort für das Seminar bekommen. Tragen sie sich dann bitte in den Gripskurs ein, weil sie dann alle weiteren Informationen über das Nachrichtenforum bekommen. Dort finden sie dann auch den Seminarplan und den Zoomlink.
Die erste reguläre Sitzung findet dann in der zweiten Semesterwoche statt.
- Trainer/in: Herbert Schwaab
Die Vorlesung bietet einen Überblick über die Geschichte und Theologie des frühen Christentums. Im Mittelpunkt stehen die großen Transformationsprozesse, die Meilensteine eines Wandels sind, der sich in den ersten sechs Jahrhunderten n.Chr. vollzieht: die Entwicklung des Christentums von einer kleinen und zunächst lokal begrenzten Bewegung am Rande des Römischen Reiches hin zur führenden Religion im Mittelmeerraum und weit darüber hinaus. Die ersten Jahrhunderte, die Gegenstand des Faches Alte Kirchengeschichte sind, stellen die grundlegende und formierende Zeit des Christentums hinsichtlich seiner kirchlichen Strukturen, seiner Glaubensüberzeugungen, des liturgischen Lebens und seiner gesellschaftlichen Relevanz im Kräfteverhältnis bzw. im Austausch mit seiner Welt und Umwelt dar.
Das an die Vorlesung anschließende Proseminar findet in Verbindung mit der Basismodulvorlesung statt und vertieft diese inhaltlich durch die Einführung in die wichtigsten Methoden und Hilfsmittel des Faches. Eine Literaturliste wird am Beginn der Vorlesung ausgegeben und an entsprechender Stelle kommentiert.

- Trainer/in: Marko Jovanovic
- Trainer/in: Andrea Riedl
- Trainer/in: Benedikt Schramm
Herzlich willkommen auf der GRIPS-Kurs GTE !
Der GTE-Kurs für die Studenten der Zahnmedizin ist neu, der erst ab diesem Semester eingeführt wurde.
Bei der inhaltlichen Gestaltung des Kurses arbeiten wir eng mit dem Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Würzburg zusammen.
Unser Angebot besteht aus 11 Vorlesungen, die wöchentlich zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich um die entsprechenden Kurse zu Themen: Theorie, Geschichte und Ethik der Medizin in der Form von vertonten Power Point-Präsentationen, welche wir ab der ersten Semesterwoche regelmäßig aus Würzburg erhalten werden. Diese werden zeitnah in GRIPS Woche für Woche hochgeladen. Diese stehen Ihnen zum Selbststudium zur Verfügung.
Darüber hinaus wird es im Januar 2025 zwei Ethikseminare geben, die wir Ihnen rechtzeitig in GRIPS ankündigen werden.
Anschließend findet dann die Klausur (Single-Choise-Fragen) an. Informationen dazu folgen.
Bei allen Fragen stehe ich Ihnen als GTE-Lehrkoordinator sehr gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Prof. Dr. med. Robert Offner
robert.offner@ukr.de
Tel. 0941 944 6266
- Trainer/in: Retna Belej
- Trainer/in: Robert Offner
- Trainer/in: Raphael Werner
Veranstaltungstyp: Proseminar
Vorlesungsverzeichnis Nr.: 33 196
Zeit: Di 12-14
Dauer: 2 Semesterwochenstunden
Turnus: wöchentlich
Beginn: 3.5.2011
Raum: Wios 017
Ein begleitendes Tutorium wird angeboten.
Dieses Methoden-Proseminar richtet sich in erster Linie an Studienanfänger sowie Studierende der ersten Semester und bietet einen ersten Einblick in die Methoden und Hilfsmittel des wissenschaftlichen Arbeitens. Neben der Vermittlung von methodischen Kenntnissen bietet das Proseminar vielfältige Möglichkeiten zur Anwendung zentraler Arbeits- und Präsentationstechniken (Bsp. Recherche /Quellenarbeit). Das Proseminar führt andererseits in wichtige geschichts- und kulturwissenschaftliche Theorien ein und soll Studierende zur Reflexion über die Grundlagen des eigenen Fachs anregen. Wir werden uns dabei sowohl mit zentralen Autoren der Geschichts- und Kulturwissenschaften sowie mit dem speziellen Erkenntnissinteresse ausgewählter Teildisziplinen (z.B. Sozial-, Kultur-, Alltags-, Geschlechter-Geschichte, historische Anthropologie) auseinandersetzen. Diese methodologischen und theoretischen Kenntnisse werden die Studierenden im Laufe des Semesters anhand eines selbstgewählten Themas zur neuesten südosteuropäischen Geschichte individuell umzusetzen lernen.
Literatur: Nils Freytag, Wolfgang Piereth: Kursbuch Geschichte. Paderborn, München und Wien.2006. Ernst Opgenoorth: Einführung in das Studium der neueren Geschichte. Paderborn 1997. Harald Roth (Hg.): Studienhandbuch Östliches Europa. Band 1: Geschichte Ostmittel- und Südosteuropas. Ute Daniel: Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 2001.
Ein ausführlicher Reader wird zu Beginn des Semesters online bei Moodle (https://elearning.uni-regensburg.de/login/index.php) eingestellt.
Anmeldung: Anmeldung bis 01.05.2011 mit Email an friederike.kind-kovacs@geschichte.uni-regensburg.de bzw. unter https://elearning.uni-regensburg.de/
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M
Leistungspunkte: 7
Leistungsanforderungen:
- Aktive und regelmäßige Teilnahme (inklusive Moodle-Beteiligung)
- Referat
- Sprachklausur (Semestermitte)
- Abschlussklausur
- Hausarbeit
- Trainer/in: Friederike Kind-Kovács
Das Ende des Kalten Kriegs hat den Blick auf die Welt
und auf die Vergangenheit verändert. Zahlreiche keineswegs neue Fragen und
Kontroversen wurden nun mit neuer Vehemenz verhandelt. Medien, Politik und diverse Interessengruppen
rückten Fakten und Ereignisse wie Völkermord, stalinistische Verbrechen,
Bespitzelung, Vertreibungen, sexualisierte Kriegsgewalt und Bombardierungen in
den Brennpunkt des öffentlichen Interesses. Grundlegend ist dabei u.a. die
Anerkennung von Opfern und der Umgang mit ihnen. In der Aushandlung von
Bewertungen und Wertigkeiten, von Unrecht und Wiedergutmachung, von den
Prämissen der Aufarbeitung und Gedenkstättenpolitik sind die Opferverbände
wichtige Akteure. Der Umgang mit der nationalsozialistischen und mit der
sozialistischen Diktatur stehen sowohl in Deutschland als auch in den
postsozialistischen Ländern in einem komplexen Zusammenhang. Ton, Rhetorik und
Deutungsmuster knüpfen dabei auf unterschiedliche Art an den Kalten Krieg an.
Dies soll anhand einiger Beispiele, die die deutsche, die tschechische und die
polnische Geschichte betreffen exemplarisch nachvollzogen werden.
- Trainer/in: Natali Stegmann
Seit jeher sind Gespenster Besucher der Welt der Lebenden, und besonders aktiv sind sie in der Welt der Fiktion. Wenn die Toten zu den Lebenden zurückkehren, kann ihre Botschaft jeweils tröstend, beängstigend, oder plagend sein. Gespenster können helfen oder verfolgen, sie können versöhnen oder rächen. Im Leben wie in der Literatur begleiten Gespenster die menschliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und den Problemen der Gegenwart. Wie beeinflussen z.B. Religion, Wissenschaft und Folklore die Darstellung von Gespenstern?
In diesem Kurs werden wir Gespenstererscheinungen betrachten, die in der deutschen und europäischen Literatur zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert vorkommen und diese Phänomene in ihrem medialen Kontext untersuchen. Insbesondere werden wir uns auf die Jahrhundertwende (um 1900) konzentrieren und ihre Gespenstererscheinungen kulturgeschichtlich interpretieren vor dem Hintergrund der Entwicklung von Spiritismus, Mediumismus, und Geisterphotographie. Von der Britischen ghost story über Geschichten von E.A. Poe, Guy de Maupassant, Henry James, Thomas Mann, Franz Kafka, bis Marie Luise Kaschnitz u.a. werden wir ein breites Korpus von Gespenstergeschichten erarbeiten um das literarische Leben der Totenerscheinungen zu befragen.
- Trainer/in: Elena Fabietti
Für
die nachhaltige Bewältigung aktueller Herausforderungen in der Arbeitswelt,
welche sich durch sich verändernde Anforderungen von Seiten des Arbeitsmarktes,
der Politik und der Gesellschaft begründen, stellen Arbeitsteams eine
Schlüsselressource für Unternehmen dar. Die Teamarbeit stellt dabei insofern einen
wichtigen Bestandteil dar, als dass Arbeitnehmer sich gegenseitig unterstützen,
zusammenarbeiten und gemeinsam lernen müssen und die komplexer werdenden
Aufgaben zu bewältigen. Auf Basis ausgewählter Forschungsergebnisse sollen
gemeinsam konkrete Ansätze zur Verbesserung der Teamarbeit erarbeitet werden,
welche sich beispielsweise auf die Arbeitskultur, das Arbeitsklima und den
Umgang mit Emotionen beziehen können. Diese Ansätze
sollen gemeinsam geübt werden, damit die Studierenden nach Abschluss des
Seminars in der Lage sind, diese in der Praxis (auch während des Studiums) anzuwenden.
- Trainer/in: Vinzenz-Philipp Gdanitz
- Trainer/in: Tim Schmidt
- Trainer/in: Louisa Marie Siemens
- Trainer/in: Andreas Widmann
- Trainer/in: Jonas Wollny
Dieser Kurs verfolgt zwei Ziele: Erstens sollen Studierende
Grundkompetenzen im Verfassen von Essays erwerben und diese auch
praktisch anwenden, d.h. philosophische Texte schreiben (lernen).
Zweitens wollen wir uns im Seminar anhand der Lektüre klassischer und
moderner Texte der Philosophie mit der Frage auseinandersetzen, welche
Gründe für oder gegen die Existenz Gottes sprechen und wer oder was
genau dabei eigentlich mit „Gott“ gemeint ist.
- Trainer/in: Hilfskräfte GP
- Trainer/in: Veronika Kalteis
- Trainer/in: Julian Maurer
- Trainer/in: Dietrich Schotte
- Trainer/in: Gertraud Kumpfmüller
Der Kurs richtet sich an alle Studierende, die über muttersprachliche Vorkenntnisse verfugen, aber Probleme mit der korrekten Aussprache, mit der Rechtsschreibung und Grammatik haben. Im Kurs werden nicht nur die Grundlagen der Rechtschreibung und Grammatik (Kasus, Possesivpronomen und reflexive Possesivpronomen Präsens, Konditional, Kongruenz besonders mit Zahlen, Aspekt und Enklitika) vermittelt, sondern auch wird die Textproduktion (Lebenslauf, Motivationsbriefe und argumentative Texte) geübt, so dass die Studierenden ihre Vorkenntnisse festigen und vor allem ausbauen können.
- Trainer/in: Zrinka Kolakovic
Der Kurs richtet sich an alle Studierende, die über muttersprachliche Vorkenntnisse verfugen, aber Probleme mit der korrekten Aussprache, mit der Rechtsschreibung und Grammatik haben. Im Kurs werden nicht nur die Grundlagen der Rechtschreibung vermittelt, sondern auch wird die Textproduktion geübt, so dass die Studierenden ihre Vorkenntnisse festigen und vor allem ausbauen können.
- Trainer/in: Zrinka Kolakovic
In dem Grundkurs wird die bayerische Geschichte im sog. kurzen 20. Jahrhundert behandelt, d.h. die Zeit ab 1918. Der Zeitraum lässt sich in drei Phasen gliedern: in den Freistaat Bayern während der Weimarer Republik, die Zeit des Nationalsozialismus und in den Wiederaufbau Bayerns nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach einem Rückblick auf das Königreich Bayern, das seit 1871 ein Gliedstaat des Kaiserreichs war, wird die Revolution vom November 1918 betrachtet. Sie besiegelte den Untergang der Monarchie und brachte die Gründung des Freistaats Bayern. Nach einer turbulenten Entwicklung bis hin zur kommunistischen Räterepublik schlug das Pendel in die entgegengesetzte Richtung aus und Bayern wurde v.a. in den Anfangsjahren der Weimarer Republik ein Hort reaktionärer Kräfte. 1933 wurde auch Bayern gleichgeschaltet und sank unter der nationalsozialistischen Herrschaft zur Provinz herab. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde unter der amerikanischen Besatzungsherrschaft die Staatlichkeit Bayerns wiederhergestellt und ein demokratisches System aufgebaut. Etwas widerstrebend gliederte sich der Freistaat in die neu entstehende Bundesrepublik ein und versteht sich dabei bis heute als Hort des Föderalismus. Wirtschaftlich machte Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg einen völligen Strukturwandel durch und entwickelte sich vom agrarisch bestimmten Staat zum Industriestaat.
Den Schwerpunkt des Grundkurses nimmt die politische Geschichte ein. Aber auch die Verfassungs-, Rechts-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte werden behandelt. Es sollen vor allem grundlegende Strukturen und Entwicklungen vermittelt, wichtige Personen vorgestellt und zentrale Begriffe geklärt werden.
Leistungsnachweis: Klausur
- Trainer/in: Georg Köglmeier
- Trainer/in: Burkard Porzelt
Glauben korrelativ kommunizieren. Einblicke in die Hermeneutik religiöser Bildung
Communicating faith tradition in correlative ways. Insights into hermeneutics of religious education
VORLESUNG (Gy, B.A.: Aufbaumodul Religionspädagogik u. Praktische Theologie: Religionspädagogik; UF GS/MS/RS, B.A.: Aufbaumodul Religionspädagogik)
Dienstag, 16 bis 18 Uhr (2 st)
Mit dem Abschied von einer die Übernahme satzhafter Wahrheiten anstrebenden Glaubensunterweisung entwickelte sich Korrelation zum Leitkonzept der Religionspädagogik. Korrelative Bildungsprozesse zielen darauf, heutige Menschen in einen kritischen, ebenbürtigen und ergebnisoffenen Erfahrungsdialog mit der Glaubenstradition zu verwickeln, der helfen soll, sich eigener Lebensdeutungen bewusst zu werden, sie zu klären und begründet weiterzuentwickeln. Die Vorlesung beleuchtet die Entdeckung, besondere ‚Logik‘ sowie Chancen und Grenzen einer korrelativen Kommunikation des christlichen Glaubens, dessen (Selbst-)Verständlichkeit ja rasant schwindet. Zielpunkt sind praxisnahe Impulse für eine korrelative Unterrichtsgestaltung.
Basis- und Begleitlektüre: Burkard Porzelt, Glauben korrelativ kommunizieren. Annäherungen an das religionspädagogische Korrelationsprinzip, Bad Heilbrunn (Klinkhardt / UTB) 2023.
- Trainer/in: Burkard Porzelt
Blockveranstaltung vom 30.09.2019-02.10.2019, jeweils 10-18 Uhr (PT 2.0.9)
Vorbesprechung am 11.09.2019, 10-12 Uhr (PT 2.0.9)
Kaum ein anderes Werk der mittelalterlichen Literatur steht so sehr für den „europäischen Mythos von der Liebe“ (Christoph Huber) wie Gottfrieds ´Tristan`. Im Mittelpunkt steht die überwältigende, leidenschaftliche Liebe zwischen Tristan und Isolde, die sich gegen gesellschaftliche Normen auflehnt und schließlich scheitert - ohne jedoch als Wert an sich in Frage gestellt zu werden. Das Besondere an Gottfrieds Gestaltung des Stoffes, der im Mittelalter in ganz Europa verbreitet war, ist, dass er die Verantwortung für die fatale Minnebindung in die Hände der Liebenden legt und den sagenumwobenen Minnetrank in den Hintergrund treten lässt. Gottfrieds Bearbeitung ist provokant und nutzt den Freiraum, den die Literatur auch in einer Zeit bietet, die für die Unerbittlichkeit ihrer sozialen Normen bekannt ist.
Das Seminar bietet neben einem allgemeinen interpretatorischen Zugang zum ‘Tristan’ die Möglichkeit, ausgewählte thematische Schwerpunkte zu vertiefen.
Eine genaue Textkenntnis von Gottfrieds ´Tristan` ist Teilnahmevoraussetzung für das Seminar!
Das Seminar wird von einem Schreibtutorium begleitet, um die TeilnehmerInnen beim Anfertigen der Seminararbeit zu unterstützen.
Literatur:
Textgrundlage:
Gottfried von Straßburg: Tristan. Mhd./Nhd. Nach dem Text von Friedrich Ranke. Neu hrsg., ins Nhd. übersetzt, mit einem Stellenkommentar und einem Nachwort von Rüdiger Krohn. Stuttgart 1993 (= RUB 4471-73).
Einführende Literatur:
Huber, Christoph: Gottfried von Straßburg. Tristan. 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin 2013 (= Klassiker-Lektüren 3).
- Trainer/in: Sonja Emmerling
- Trainer/in: Susanne Maryam Müller
Die Textgrammatik ist die Basis der Textanalyse. Sie setzt die Strukturen des Satzes als bekannt voraus und weitet die Analyse gleichsam nach oben auf den ganzen Text aus, bleibt aber nicht beim Kleintext (Prototyp: Zeitungsmeldung) stehen, sondern erfasst auch den „Großtext", der als Kombination aus Kleintexten erfasst wird. Die wichtigsten Themenbereiche, die in der Vorlesung behandelt werden, betreffen die sprachlichen Mittel und Regeln, mit denen in der deutschen Sprache Texte ausdrucksseitig und inhaltsseitig kohärent gemacht werden können.
- Trainer/in: Manuel Glondys
- Trainer/in: Simone Meindl
In seiner postkolonialen Theorie betrachtet Homi Bhabha Kultur unter dem Aspekt eines dritten Raums, eines Überlappungsraums zwischen verschiedenen, ungleichzeitigen, inkommensurablen Kulturen, ein Grenzgebiet. Bewohner dieses Gebiets leben jenseits nationaler Grenzen, befinden sich in “einem Moment des Übergangs, in dem Raum und Zeit sich überschneiden, um komplexe Gebilde von Differenz und Identität, von Vergangenheit und Gegenwart, Innen und Außen, Inklusion und Exklusion auszubilden” (Bhabha 2004,2). Ein kurzer Streifzug durch das deutsch-tschechische Grenzgebiet genügt, um einen Einblick in diesen dritten Raum zu gewinnen, der sowohl in seiner Sprache, in seinen Ortschaften und Texten gemeinsame Geschichte, Zusammenleben und Erinnerungen als auch Trennung und Auseinandersetzung aufzeichnet.
Sowohl Tschechische als auch deutsche Regisseure haben sich mit dem bewegten deutsch-tschechischen Zusammen- und Auseinanderleben in vielen Filmen auseinandergesetzt, prägen dabei das kulturelle Gedächtnis durch das Massenmedium. Ziel dieses Kurses ist es, repräsentativen Filme über das Grenzgebiet seit dem Zweiten Weltkrieg bis in jüngsten Vergangenheit nachzugehen, um tschechische und deutsche Blicke auf den dritten Raum aufzuspüren und kritisch zu analysieren. Dabei sollen durch die zeitliche Spanne des Kurses Verschiebungen in der Wahrnehmung des Grenzgebiets und des Anderen erfasst werden. Die Beschäftigung mit Filmen und deren Entstehungskontext soll zur Reflexion unserer Identitäten und der Bilder von unseren jeweiligen Nachbarn anregen und uns helfen, filmanalytische Kompetenzen zu entwickeln.
- Trainer/in: Kenneth Hanshew
- Trainer/in: Michael Krewet
- Trainer/in: Josef Hofmaier
- Trainer/in: Sergiusz Kazmierski
- Trainer/in: Florian März
Bürgerschaft ist einer der zentralen Begriffe, mit denen sich die
Politische Philosophie in ihrer begrifflich-normativen Analyse von
Staatsdenken beschäftigt. Der Grundkurs führt anhand der gemeinsamen
systematischen Analyse und Diskussion zentraler Quellentexte in diesen
Themenkomplex ein. Dabei werden wir uns unter anderem mit folgenden
Fragen beschäftigen: Was bedeutet Bürgerschaft? Inwiefern korrespondiert
das Verständnis von Bürgerschaft (und der Entwurf eines spezifischen
Bürgerideals) mit der Konzeption des Staates? Und welche
anthropologischen Annahmen liegen einem konkreten Bürgerverständnis
zugrunde? Anhand ausgewählter Hauptwerke widmen wir uns dem Staats- und
Bürgerschaftsverständnis dreier zentraler Denker*innen, die mit ihrem
Denken die politische Philosophie maßgeblich geprägt haben –
Aristoteles, Thomas Hobbes und Hannah Arendt – und tauchen damit in
verschiedenen Epochen politischen Denkens (Antike, Neuzeit, Moderne)
ein. Dabei soll nicht nur eine Gegenüberstellung der Texte, sondern auch
die Erarbeitung der Bezüge und Einflüsse zwischen den drei
Philosoph*innen erfolgen. Die gemeinsame Arbeit mit Quellentexten sowie
die Diskussion der verschiedenen Konzepte zielen neben der vertieften
Kenntnis zentraler Positionen der politischen Philosophie und
Ideengeschichte auf den Erwerb der fachgebietsspezifischen Arbeitsweise
und insbesondere das Erlernen hermeneutischer, analytischer und
argumentativer Kompetenzen ab. Die Teilnahme am Grundkurs setzt die
Bereitschaft zu intensiver Textlektüre und aktiver Mitarbeit voraus.
- Trainer/in: Politische Philosophie
- Trainer/in: Ricarda Wünsch
Im Kurs werden elementare Kenntnisse des Albanischen vermittelt: Grundzüge der Grammatik, Erwerb von Grundwortschatz und von kommunikativen Fähigkeiten sowohl im Schriftlichen als auch im Mündlichen.
- Trainer/in: Ledio Hala
| Kommentar |
Die Veranstaltung soll einen grundlegenden Einblick in das Thema der dynamischen Computersimulation geben. In einem ersten Schritt werden die notwendigen Hintergründe und theoretische Grundlagen erörtert. Darauf aufbauend werden unterschiedliche Anwendungsfelder mit ihren zugehörigen Fragestellungen und Modellierungsansätzen exemplarisch beleuchtet. Abschließen wird den Kurs eine praktische Einheit, in der jeder Teilnehmer den Umgang mit der Mehr-Methoden Simulationssoftware AnyLogic erlernen und konkrete Fragestellungen praktisch umsetzen und analysieren soll. |
|---|---|
| Literatur |
Hedtstück, Ulrich (2013): Simulation diskreter Prozesse. Methoden und Anwendungen. Berlin: Springer. Liebl, Franz (1992): Simulation. Problemorientierte Einführung. München: Oldenbourg. Page, Bernd (1991): Diskrete Simulation. Eine Einführung mit Modula-2. Berlin : Springer (Springer-Lehrbuch). Bossel, Hartmut (2004): Systeme, Dynamik, Simulation. Modellbildung, Analyse und Simulation komplexer Systeme. Norderstedt: Books on Demand. Bungartz, Hans-Joachim (Hg.) (2009): Modellbildung und Simulation. Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin: Springer (eXamen.press). Kahlert, Jörg (2004): Simulation technischer Systeme. Eine beispielorientierte Einführung. 1. Aufl. Wiesbaden: Vieweg (Vieweg Praxiswissen). Ross, Sheldon M. (2006): Simulation. 4. Aufl. Amsterdam: Elsevier Acad. Press. Sauerbier, Thomas (1999): Theorie und Praxis von Simulationssystemen. Eine Einführung für Ingenieure und Informatiker ; mit Programmbeispielen und Projekten aus der Technik. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg (Studium Technik). |
| Voraussetzungen |
Kenntnisse mindestens einer höheren Programmiersprache, bevorzugt Java |
| Leistungsnachweis |
regelmäßige Teilnahme Übungsaufgaben erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit |
- Trainer/in: Martin Brockelmann
- Trainer/in: Stephan Mikes
| Kommentar |
Die Veranstaltung soll einen grundlegenden Einblick in das Thema der dynamischen Computersimulation geben. In einem ersten Schritt werden die notwendigen Hintergründe und theoretische Grundlagen erörtert. Darauf aufbauend werden unterschiedliche Anwendungsfelder mit ihren zugehörigen Fragestellungen und Modellierungsansätzen exemplarisch beleuchtet. Abschließen wird den Kurs eine praktische Einheit, in der jeder Teilnehmer den Umgang mit der Mehr-Methoden Simulationssoftware AnyLogic erlernen und konkrete Fragestellungen praktisch umsetzen und analysieren soll. |
|---|---|
| Literatur |
Hedtstück, Ulrich (2013): Simulation diskreter Prozesse. Methoden und Anwendungen. Berlin: Springer. Liebl, Franz (1992): Simulation. Problemorientierte Einführung. München: Oldenbourg. Page, Bernd (1991): Diskrete Simulation. Eine Einführung mit Modula-2. Berlin : Springer (Springer-Lehrbuch). Bossel, Hartmut (2004): Systeme, Dynamik, Simulation. Modellbildung, Analyse und Simulation komplexer Systeme. Norderstedt: Books on Demand. Bungartz, Hans-Joachim (Hg.) (2009): Modellbildung und Simulation. Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin: Springer (eXamen.press). Kahlert, Jörg (2004): Simulation technischer Systeme. Eine beispielorientierte Einführung. 1. Aufl. Wiesbaden: Vieweg (Vieweg Praxiswissen). Ross, Sheldon M. (2006): Simulation. 4. Aufl. Amsterdam: Elsevier Acad. Press. Sauerbier, Thomas (1999): Theorie und Praxis von Simulationssystemen. Eine Einführung für Ingenieure und Informatiker ; mit Programmbeispielen und Projekten aus der Technik. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg (Studium Technik). |
| Voraussetzungen |
Kenntnisse mindestens einer höheren Programmiersprache, bevorzugt Java |
| Leistungsnachweis |
regelmäßige Teilnahme Übungsaufgaben erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit |
- Trainer/in: Martin Brockelmann
- Trainer/in: Stephan Mikes
| Kommentar |
Die Veranstaltung soll einen grundlegenden Einblick in das Thema der dynamischen Computersimulation geben. In einem ersten Schritt werden die notwendigen Hintergründe und theoretische Grundlagen erörtert. Darauf aufbauend werden unterschiedliche Anwendungsfelder mit ihren zugehörigen Fragestellungen und Modellierungsansätzen exemplarisch beleuchtet. Abschließen wird den Kurs eine praktische Einheit, in der jeder Teilnehmer den Umgang mit der Mehr-Methoden Simulationssoftware AnyLogic erlernen und konkrete Fragestellungen praktisch umsetzen und analysieren soll. |
|---|---|
| Literatur |
Hedtstück, Ulrich (2013): Simulation diskreter Prozesse. Methoden und Anwendungen. Berlin: Springer. Liebl, Franz (1992): Simulation. Problemorientierte Einführung. München: Oldenbourg. Page, Bernd (1991): Diskrete Simulation. Eine Einführung mit Modula-2. Berlin : Springer (Springer-Lehrbuch). Bossel, Hartmut (2004): Systeme, Dynamik, Simulation. Modellbildung, Analyse und Simulation komplexer Systeme. Norderstedt: Books on Demand. Bungartz, Hans-Joachim (Hg.) (2009): Modellbildung und Simulation. Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin: Springer (eXamen.press). Kahlert, Jörg (2004): Simulation technischer Systeme. Eine beispielorientierte Einführung. 1. Aufl. Wiesbaden: Vieweg (Vieweg Praxiswissen). Ross, Sheldon M. (2006): Simulation. 4. Aufl. Amsterdam: Elsevier Acad. Press. Sauerbier, Thomas (1999): Theorie und Praxis von Simulationssystemen. Eine Einführung für Ingenieure und Informatiker ; mit Programmbeispielen und Projekten aus der Technik. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg (Studium Technik). |
| Voraussetzungen |
Kenntnisse mindestens einer höheren Programmiersprache, bevorzugt Java |
| Leistungsnachweis |
regelmäßige Teilnahme Übungsaufgaben erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit |
- Trainer/in: Martin Brockelmann
- Trainer/in: Stephan Mikes
| Kurzkommentar |
Corona Update: findet zunächst als digitale Veranstaltung statt, ab xx wieder als |
|---|---|
| Kommentar |
Die Veranstaltung soll einen grundlegenden Einblick in das Thema der dynamischen Computersimulation geben. In einem ersten Schritt werden die notwendigen Hintergründe und theoretische Grundlagen erörtert. Darauf aufbauend werden unterschiedliche Anwendungsfelder mit ihren zugehörigen Fragestellungen und Modellierungsansätzen exemplarisch beleuchtet. Abschließen wird den Kurs eine praktische Einheit, in der jeder Teilnehmer den Umgang mit der Mehr-Methoden Simulationssoftware AnyLogic erlernen und konkrete Fragestellungen praktisch umsetzen und analysieren soll. |
| Literatur |
Hedtstück, Ulrich (2013): Simulation diskreter Prozesse. Methoden und Anwendungen. Berlin: Springer. Liebl, Franz (1992): Simulation. Problemorientierte Einführung. München: Oldenbourg. Page, Bernd (1991): Diskrete Simulation. Eine Einführung mit Modula-2. Berlin : Springer (Springer-Lehrbuch). Bossel, Hartmut (2004): Systeme, Dynamik, Simulation. Modellbildung, Analyse und Simulation komplexer Systeme. Norderstedt: Books on Demand. Bungartz, Hans-Joachim (Hg.) (2009): Modellbildung und Simulation. Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin: Springer (eXamen.press). Kahlert, Jörg (2004): Simulation technischer Systeme. Eine beispielorientierte Einführung. 1. Aufl. Wiesbaden: Vieweg (Vieweg Praxiswissen). Ross, Sheldon M. (2006): Simulation. 4. Aufl. Amsterdam: Elsevier Acad. Press. Sauerbier, Thomas (1999): Theorie und Praxis von Simulationssystemen. Eine Einführung für Ingenieure und Informatiker ; mit Programmbeispielen und Projekten aus der Technik. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg (Studium Technik). |
| Voraussetzungen |
Kenntnisse mindestens einer höheren Programmiersprache, bevorzugt Java |
| Leistungsnachweis |
regelmäßige Teilnahme Übungsaufgaben erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit
|
| Lerninhalte |
Für Studierende der Medieninformatik mit Studienbeginn im WS 17/18: Für den Abschluss des Moduls MEI-BA-M 09 sind FlexNow-Anmeldungen in MEI-BA-M09.1 UND MEI-BA-M09.2 erforderlich. |
- Trainer/in: Martin Brockelmann
- Trainer/in: Stephan Mikes
| Kommentar | Die Veranstaltung soll einen grundlegenden Einblick in das Thema der dynamischen Computersimulation geben. In einem ersten Schritt werden die notwendigen Hintergründe und theoretische Grundlagen erörtert. Darauf aufbauend werden unterschiedliche Anwendungsfelder mit ihren zugehörigen Fragestellungen und Modellierungsansätzen exemplarisch beleuchtet. Abschließen wird den Kurs eine praktische Einheit, in der jeder Teilnehmer den Umgang mit der Mehr-Methoden Simulationssoftware AnyLogic erlernen und konkrete Fragestellungen praktisch umsetzen und analysieren soll. |
|---|---|
| Literatur | Hedtstück, Ulrich (2013): Simulation diskreter Prozesse. Methoden und Anwendungen. Berlin: Springer. Liebl, Franz (1992): Simulation. Problemorientierte Einführung. München: Oldenbourg. Page, Bernd (1991): Diskrete Simulation. Eine Einführung mit Modula-2. Berlin : Springer (Springer-Lehrbuch). Bossel, Hartmut (2004): Systeme, Dynamik, Simulation. Modellbildung, Analyse und Simulation komplexer Systeme. Norderstedt: Books on Demand. Bungartz, Hans-Joachim (Hg.) (2009): Modellbildung und Simulation. Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin: Springer (eXamen.press). Kahlert, Jörg (2004): Simulation technischer Systeme. Eine beispielorientierte Einführung. 1. Aufl. Wiesbaden: Vieweg (Vieweg Praxiswissen). Ross, Sheldon M. (2006): Simulation. 4. Aufl. Amsterdam: Elsevier Acad. Press. Sauerbier, Thomas (1999): Theorie und Praxis von Simulationssystemen. Eine Einführung für Ingenieure und Informatiker ; mit Programmbeispielen und Projekten aus der Technik. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg (Studium Technik). |
| Voraussetzungen | Kenntnisse mindestens einer höheren Programmiersprache, bevorzugt Java |
| Leistungsnachweis | regelmäßige Teilnahme Übungsaufgaben erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit
|
| Lerninhalte | Für Studierende der Medieninformatik mit Studienbeginn im WS 17/18: Für den Abschluss des Moduls MEI-BA-M 09 sind FlexNow-Anmeldungen in MEI-BA-M09.1 UND MEI-BA-M09.2 erforderlich. |
- Trainer/in: Martin Brockelmann
- Trainer/in: Stephan Mikes
| Kommentar | Die Veranstaltung soll einen grundlegenden Einblick in das Thema der dynamischen Computersimulation geben. In einem ersten Schritt werden die notwendigen Hintergründe und theoretische Grundlagen erörtert. Darauf aufbauend werden unterschiedliche Anwendungsfelder mit ihren zugehörigen Fragestellungen und Modellierungsansätzen exemplarisch beleuchtet. Abschließen wird den Kurs eine praktische Einheit, in der jeder Teilnehmer den Umgang mit der Mehr-Methoden Simulationssoftware AnyLogic erlernen und konkrete Fragestellungen praktisch umsetzen und analysieren soll. |
|---|---|
| Literatur | Hedtstück, Ulrich (2013): Simulation diskreter Prozesse. Methoden und Anwendungen. Berlin: Springer. Liebl, Franz (1992): Simulation. Problemorientierte Einführung. München: Oldenbourg. Page, Bernd (1991): Diskrete Simulation. Eine Einführung mit Modula-2. Berlin : Springer (Springer-Lehrbuch). Bossel, Hartmut (2004): Systeme, Dynamik, Simulation. Modellbildung, Analyse und Simulation komplexer Systeme. Norderstedt: Books on Demand. Bungartz, Hans-Joachim (Hg.) (2009): Modellbildung und Simulation. Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin: Springer (eXamen.press). Kahlert, Jörg (2004): Simulation technischer Systeme. Eine beispielorientierte Einführung. 1. Aufl. Wiesbaden: Vieweg (Vieweg Praxiswissen). Ross, Sheldon M. (2006): Simulation. 4. Aufl. Amsterdam: Elsevier Acad. Press. Sauerbier, Thomas (1999): Theorie und Praxis von Simulationssystemen. Eine Einführung für Ingenieure und Informatiker ; mit Programmbeispielen und Projekten aus der Technik. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg (Studium Technik). |
| Voraussetzungen | Kenntnisse mindestens einer höheren Programmiersprache, bevorzugt Java |
| Leistungsnachweis | regelmäßige Teilnahme Übungsaufgaben erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit
|
| Lerninhalte | Für Studierende der Medieninformatik mit Studienbeginn im WS 17/18: Für den Abschluss des Moduls MEI-BA-M 09 sind FlexNow-Anmeldungen in MEI-BA-M09.1 UND MEI-BA-M09.2 erforderlich. |
- Trainer/in: Martin Brockelmann
- Trainer/in: Stephan Mikes