- Trainer/in: Solveig Ottmann
- Trainer/in: Kristina Senft
GRIPS - Uni Regensburg
Suchergebnisse: 1760
Dass Medien nicht nur von Sport berichten, sondern auch erst die Konstitution einer Realität des Sports ermöglichen, ist eine Ansicht, die in den letzten Jahren in der Medienwissenschaft intensiv diskutiert wird. Medien beobachten den Sport, öffnen ihn für die Analyse, ermöglichen die Begutachtung sportlicher Leistungen. Ebenso bietet der Sport als populäre kulturelle Form die Möglichkeit, innovative Medientechnologien auszuprobieren und zu bewerben, wird Mediensport zu einem Bezugspunkt des medialen Wandels. Dieses Seminar untersucht die Mediatisierung von Sport in unterschiedlichen Bereichen: Die Inszenierung von Sport in Film und Fernsehen, die Veränderung der stilistischen und medientechnologischen Mitteln in der Repräsentation von Sportinhalten, die Darstellung und Ästhetisierung des Körpers, die Veränderung des Mediensports durch Internet-Medien wie YouTube, die Mediatisierung des Freizeitsports durch den Einsatz von Mediengeräten wie dem I-Phone und Fitness-Apps. Im Seminar sollen grundlegende medienwissenschaftliche Texte zum Sport gelesen und diskutiert werden sowie einzelne Sportarten und ihre mediale Darstellung sowie ihre medienkulturelle Bedeutung untersucht werden.
Organisation und Anforderungen:
Ein großer Teil des Seminars wird über die Lehrplattform Grips organisiert. Es wird eine Mischung aus folgenden Elementen sein, die sich abwechseln werden: Aufgaben, Kommentare und Präsentationen, die in Foren zu den jeweiligen Sitzungen eigenständig auf Grips hochgeladen werden, und Zoomsitzungen, in denen ihre Beiträge diskutiert werden sollen und Impulse für die Seminarthemen gegeben werden. Die Beiträge und Analysen beziehen sich entweder auf Texten/Theorien oder auf einzelne Sportarten.
Grundlage des erfolgreichen Seminarabschluss sind die Übernahme von Aufgaben für die Seminarsitzungen und das Verfassen einer Hausarbeit (ca. 12 Seiten).
Wichtig: Sie werden, wenn sie sich für den Kurs auf Lsf eingetragen haben, ab der ersten Vorlesungwoche, also ab Montag dem 12. April, per Mail das Passwort für das Seminar bekommen. Tragen sie sich dann bitte in den Gripskurs ein, weil sie dann alle weiteren Informationen über das Nachrichtenforum bekommen. Dort finden sie dann auch den Seminarplan und den Zoomlink.
Die erste reguläre Sitzung findet dann in der zweiten Semesterwoche statt.
- Trainer/in: Herbert Schwaab
- Trainer/in: Sabine Fredersdorf
- Trainer/in: Christina Kolbeck
Dieser Kurs dient der Orientierung der Erstsemester der Medizinischen Informatik mit Studienstart WiSe 2020/2021.
Bitte schreiben Sie sich in diesen Kurs nur dann ein, wenn Sie im Wintersemester 2020/2021 im Studiengang Medizinische Informatik begonnen haben. Sie bekommen hier keine Informationen für höhere Semester!
- Trainer/in: Eva Neumaier
- Trainer/in: Christoph Palm
Mehrseitige Sicherheit: Anonyme Kommunikationssysteme, SS 2025
Mehrseitige Sicherheit bedeutet die Einbeziehung der Schutzinteressen aller Beteiligten sowie das Austragen daraus resultierender Schutzkonflikte beim Entstehen einer Kommunikationsverbindung. Gerade verteilte Systeme sind hervorragend als Basis mehrseitig sicherer Systeme geeignet. Am Fallbeispiel datenschutzfreundlicher Technologien (z.B. Broadcast, Mix-Netz, DC-Netz) wird gezeigt, wie Verteiltheit zur Realisierung der Sicherheitsanforderungen unterstützend wirkt und anonym kommuniziert werden kann.
- Trainer/in: Alperen Aksoy
- Trainer/in: Marc Roßberger
- Trainer/in: Kesdogan Technik
- Trainer/in: Stefan Winderl
Mehrsprachigkeit
kommt im (schulischen) DaZ-Kontext eine zentrale Bedeutung zu. Dieses
Seminar beschäftigt sich mit verschiedenen Facetten des
Mehrsprachigkeitsbegriffs und ausgewählten Ansätzen der
Mehrsprachigkeitsdidaktik.
Geplant sind auch Gastvorträge aus der Praxis
Für DaZ-Studierende ist das erfolgreich absolvierte Grundlagenmodul Voraussetzung für die Teilnahme!
- Trainer/in: Juliette Breton
Seit ca. zwei Jahrzehnten findet die Tatsache, dass Lernende des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache, auf andere, im Vorfeld gelernte Sprachen zurückgreifen können, bzw. ihr Deutschlernen vom Beherrschen und Lernen dieser geprägt wird, in der Forschung Beachtung. Zahlreiche Bereiche der Psycholinguistik von Kognition über die Rolle der Emotionen bis zum Aufbau des mehrsprachigen mentalen Lexikons werden einerseits aus der Sicht der Mehrsprachigkeitsdidaktik reflektiert. Andererseits werden Potenziale in Bezug auf eine Kompetenz in einer weiteren Fremdsprache, die aktuell noch nicht spezifischer Lerngegenstand ist (vgl. EuroComGerm in Hufeisen/Marx 2007), entdeckt. Vor über zehn Jahren löst sich Deutsch als Tertiärsprachendidaktik von allgemeineren Konzepten der Mehrsprachigkeitsdidaktik (vgl. Hufeisen/Riemer (2010, 747f) bzw. Marx/Hufeisen (2010, 826ff).
Im Rahmen dieses Seminars werden Konzepte der Mehrsprachigkeitsdidaktiken bzw. spezifisch das Konzept der Tertiärsprachendidaktik in Bezug auf Deutsch als Fremdsprache theoretisch und praktisch untersucht. Als Leitfaden dient das Heft Nr. 50 der Zeitschrift Fremdsprache Deutsch (2014), das dem Thema „Mehrsprachigkeit“ gewidmet ist. Vor speziellen Fragen wie der der Interkomprehension und Falschen Freunde werden die psycholinguistischen Grundlagen des Sprach- und Fremdsprachenerwerbs (u.a. L2-Erwerbsmodelle, benachbarte linguistische Ansätze, personale und soziale Faktoren bzw. Modelle zur Mehrsprachigkeit und zum multiplen Sprachenlernen) behandelt und im Praxisteil werden Befragungen mit Studierenden mit einem DaF- Hintergrund (UmDieEcke, Sprachcafé) durchgeführt und interpretiert. Genauso werden aktuelle Tendenzen von Sprachen- bzw. Schulsprachenpolitik thematisiert, die Lernen und Erwerb des Deutschen als Fremdsprache beeinflussen. (Ammon 2015) U.u. können zwei Teilreferate gehalten werden. In die Hausarbeiten sollen beide Teile ihren Einfluss finden.
- Trainer/in: Akos Bitter
Seit ca. zwei Jahrzehnten findet die Tatsache, dass Lernende des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache, auf andere, im Vorfeld gelernte Sprachen zurückgreifen können, bzw. ihr Deutschlernen vom Beherrschen und Lernen dieser geprägt wird, in der Forschung Beachtung. Zahlreiche Bereiche der Psycholinguistik von Kognition über die Rolle der Emotionen bis zum Aufbau des mehrsprachigen mentalen Lexikons werden einerseits aus der Sicht der Mehrsprachigkeitsdidaktik reflektiert. Andererseits werden Potenziale in Bezug auf eine Kompetenz in einer weiteren Fremdsprache, die aktuell noch nicht spezifischer Lerngegenstand ist (vgl. EuroComGerm in Hufeisen/Marx 2007), entdeckt. Vor über zehn Jahren löst sich Deutsch als Tertiärsprachendidaktik von allgemeineren Konzepten der Mehrsprachigkeitsdidaktik (vgl. Hufeisen/Riemer (2010, 747f) bzw. Marx/Hufeisen (2010, 826ff).
Im Rahmen dieses Seminars werden Konzepte der Mehrsprachigkeitsdidaktiken bzw. spezifisch das Konzept der Tertiärsprachendidaktik in Bezug auf Deutsch als Fremdsprache theoretisch untersucht. Im Praxisteil werden Befragungen bzw. Leitfadeninterviews bei Studierenden mit einem DaF-Hintergrund (UmDieEcke, Sprachcafé) durchgeführt und interpretiert. U.u. können zwei Teilreferate gehalten werden. In die Hausarbeiten sollen beide Teile ihren Einfluss finden.
Hufeisen, Britta/Marx, Nicole (Hrsg.) (2007), EuroComGerm – Die sieben Siebe: Germanische Sprachen lesen lernen, Aachen
Hufeisen, Britta/Riemer, Claudia (2010), Spracherwerb und Sprachlernen In: Krumm, Hans-Jürgen/Fandrych, Christian/Hufeisen, Britta/Riemer, Claudia (Hrsg.) (2010), Deutsch als Fremd und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. (HSK 35.1-2), Berlin, New York, S. 738-753
Marx, Nicole/Hufeisen, Britta (2010), Mehrsprachigkeitskonzepte In: Krumm, Hans-Jürgen/Fandrych, Christian/Hufeisen, Britta/Riemer, Claudia (Hrsg.) (2010), Deutsch als Fremd und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. (HSK 35.1-2), Berlin, New York, S. 826-832
- Trainer/in: Akos Bitter
Seit ca. zwei Jahrzehnten findet die Tatsache, dass Lernende des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache, auf andere, im Vorfeld gelernte Sprachen zurückgreifen können, bzw. ihr Deutschlernen vom Beherrschen und Lernen dieser geprägt wird, in der Forschung Beachtung. Zahlreiche Bereiche der Psycholinguistik von Kognition über die Rolle der Emotionen bis zum Aufbau des mehrsprachigen mentalen Lexikons werden einerseits aus der Sicht der Mehrsprachigkeitsdidaktik reflektiert. Andererseits werden Potenziale in Bezug auf eine Kompetenz in einer weiteren Fremdsprache, die aktuell noch nicht spezifischer Lerngegenstand ist (vgl. EuroComGerm in Hufeisen/Marx 2014), entdeckt. Vor über zehn Jahren löst sich Deutsch als Tertiärsprachendidaktik von allgemeineren Konzepten der Mehrsprachigkeitsdidaktik (vgl. Hufeisen/Riemer (2010, 747f) bzw. Marx/Hufeisen (2010, 826ff). Studierende des Masterstudienganges Mehrsprachigkeit und Regionalität können ihren Schwerpunkt im oben geschilderten Zusammenhang der Mehrsprachigkeit auch auf eine andere moderne Fremdsprache legen.
Im Rahmen dieses Seminars werden Konzepte der Mehrsprachigkeitsdidaktiken bzw. spezifisch das Konzept der Tertiärsprachendidaktik in Bezug auf Deutsch als Fremdsprache evt. eine andere moderne Fremdsprache theoretisch und praktisch untersucht. Als Leitfaden dient das Heft Nr. 50 der Zeitschrift Fremdsprache Deutsch (2014), das dem Thema „Mehrsprachigkeit” gewidmet ist. Vor speziellen Fragen wie der der Interkomprehension und Falschen Freunde werden die psycholinguistischen Grundlagen des Sprach- und Fremdsprachenerwerbs (u.a. L2-Erwerbsmodelle, benachbarte linguistische Ansätze, personale und soziale Faktoren bzw. Modelle zur Mehrsprachigkeit und zum multiplen Sprachenlernen) behandelt. Im Praxisteil werden Befragungen mit Studierenden und anderen TeilnehmerInnen des Sprachcafés (vgl. Internetquelle) mit einem DaF- Hintergrund bzw. vergleichsweise einem Hintergrund mit weiteren Fremdsprachen durchgeführt und interpretiert. Genauso werden aktuelle Tendenzen von Sprachen- bzw. Schulsprachenpolitik thematisiert, die Lernen und Erwerb des Deutschen als Fremdsprache beeinflussen. (Ammon 2015) U.u. können zwei Teilreferate gehalten werden. In die Hausarbeiten sollen beide Teile ihren Einfluss finden.
Alphabetische Liste der zu behandelnden (Unter)Themen
Bildungssprache Deutsch; Code Switching/Mixing; Curriculare Mehrsprachigkeit; Deutsch im Vergleich (Deutsch als schwere Sprache); Erstsprache (Rolle); Englisch als Lingua Franca; EuroComGerm; Faktoren (kognitiv, emotional, linguistisch, fremdsprachenspezifisch); Falsche Freunde; Gesamtsprachencurricula; Interferenz; Interkomprehension; Klassische Sprachen (Rolle); Kognaten; Mehrsprachigkeit (gesellschaftlich, individuell, regional) (äußere und innere); Mehrsprachigkeitsmodelle (DaFnE/DaT, EaG etc.), Mehrsprachigkeitsdidaktik (DaF, DaZ); Mentales Lexikon; Multilingualismusfaktor (Jessner/Hufeisen); Multiples Sprachenlernen; PlurCur – Schulische Gesamtsprachencurricula; Sprachbewusstheit/Sprachbewusstsein; Sprachenreihenfolge; Sprachenvergleich; Sprachenkontakt; Spracherwerb und Sprachlernen; Sprachwechsel; Tertiärsprachendidaktik; Transfer
Literatur:
Ammon, Ulrich (2015) Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt, Berlin / München / Boston
Allgäuer-Hackl, Elisabeth/Brogan, Kristin/Henning, Ute/Hufeisen, Britta/Schlabach, Joachim (Hg.) (2015), Mehr Sprachen? - PlurCur! Berichte aus Forschung und Praxis zu Gesamtsprachencurricula. Baltmannsweiler, Schneider Hohengehren
Baur, Rupprecht/Hufeisen, Britta (Hg.) (2011), "Vieles ist sehr ähnlich." - Individuelle und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit als bildungspolitische Aufgabe . Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
Fremdsprache Deutsch Heft Nr. 50 (2014)
Hufeisen, Britta/Thonhauser, Ingo: Die „fremde” Sprache Deutsch in mehrsprachigen Lehr- und Lernkontexten
Krumm, Hans-Jürgen: Weshalb Deutsch? Sprachenpolitische Dimensionen der Fremdsprache Deutsch
Pupp Spinassé, Karen: Dialekt im Deutschunterricht? Für eine Didaktik der Mehrsprachigkeit in Brasilien
Kursiša, Anta: Lesen und verstehen, „ohne das Deutsche so besonders gut zu können” – Lesetexte im schulischen Anfangsunterricht DaFnE
Schlabach, Joachim: Auf dem Weg zur plurilingualen Kompetenz
Kohler, Patricia/Schweer, Wiebke: Werkzeuge zum mehrsprachigen Arbeiten
Vicente, Sara/Pilypaité, Lina: Mehrsprachigkeitsdidaktik in Lehrmaterialien
Sorger, Brigitte: Wie man Mehrsprachigkeit in die Köpfe bekommt
Kärchner-Ober, Renate: Deutsch im Kontext multilingualer Lernkonstellationen
Eroms, Hans-Werner: „Äußere und innere Mehrsprachigkeit”
Hufeisen, Britta/Riemer, Claudia (2010), Spracherwerb und Sprachlernen In: Krumm, Hans-Jürgen/Fandrych, Christian/Hufeisen, Britta/Riemer, Claudia (Hrsg.) (2010), Deutsch als Fremd und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. (HSK 35.1-2), Berlin, New York, S. 738-753
Hufeisen, Britta/Marx, Nicole (2014), Lernen mit den sieben Sieben im Rahmen von EuroComGerm. In: Hufeisen, Britta/Marx, Nicole (Hg.) (2014), EuroComGerm - Die Sieben Siebe. Germanische Sprachen lesen lernen. 2. vollständig überarbeitete Aufl. Aachen, Shaker, 5-20.
Marx, Nicole/Hufeisen, Britta (2010), Mehrsprachigkeitskonzepte In: Krumm, Hans-Jürgen/Fandrych, Christian/Hufeisen, Britta/Riemer, Claudia (Hrsg.) (2010), Deutsch als Fremd und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. (HSK 35.1-2), Berlin, New York, S. 826-832
Riehl, Claudia Maria (2014), Sprachkontaktforschung
Riehl, Claudia Maria (2016), Mehrsprachigkeit. Einführung
- Trainer/in: Akos Bitter
Mit Begriffen wie „Pictorial Turn“ oder „Iconic Turn“ wird seit den 1990er-Jahren eine Fokusverschiebung zu visuellen Medien umschrieben, die nicht nur eine redensartlichen „Bilderflut” in Folge der Entwicklung neuer Medien, etwa Internet oder Fernsehen, umschreibt, sondern vor allem einen sich verändernden Umgang mit Bildern. Ein wesentlicher Gegenstand dieser neuen Bildlichkeit sind Memes. Dabei handelt es sich um im Internet zirkulierende Bild-Text-Formen, die von Communities und Individuen erstellt und zirkuliert werden, um den Alltag – von der persönlichen Situation bis zur Weltpolitik – abzubilden und zu kommentieren. In der deutschen Medien- und Kommunikationswissenschaft spielt die Forschung zu Memes seit etwa zwei Jahren eine zunehmende Rolle und greift damit eine längere Beschäftigung in den internationalen Wissenschaftsdebatten auf. Memes werden hierbei als Bildmedien mit komplexer Eigenlogik, als Kommunikations- und Erzählmittel sowie als Fokalpunkt von Plattformen und Communities diskutiert. Das Seminar bietet einen Einstieg in diese Forschung. Ziel des Seminars ist es Memes als Forschungsgegenstand kennen und analysieren zu lernen.
- Trainer/in: Laura Niebling
Der moderne Alltag ist in hohem Maße in digitale Infrastrukturen eingebunden, derer wir uns häufig erst dann bewusst werden, wenn das login fehlschlägt, wenn keine Verbindung aufgebaut werden konnte, ein server überlastet ist oder wenn wir erfahren, dass persönlichen Daten in falsche Hände gelangt sind.
Auch im Kontext gesellschaftlicher Diskurse um die Frage nach Chancen und Risiken des Einsatzes künstlicher Intelligenz, etwa in Form sogenannter deep learning-Algorithmen, virtueller und augmentierter Realität(en) und allerlei „smarter“ Artefakte und Räume spiegelt sich die zunehmend komplexer werdende Verflochtenheit unseres Alltags mit digitalen Technologien.
Obgleich dieser Transformationsprozess unterschiedlichste Deutungen und Zuschreibungen erfährt, so steht doch außer Zweifel, dass sich mit dem zunehmenden Einsatz digitaler Technologien die Deutungen, Praxen und Materialitäten des Alltagslebens verändern. Im Seminar wollen wir uns daher mit der Frage beschäftigen, wie die Vergleichende Kulturwissenschaft auf Phänomene des Technischen und Digitalen blickt und wie sich die Reziprozität und Relationalität von Mensch, Technik und Algorithmus kulturanalytisch fassen und methodisch greifbar machen lässt.
Im ersten Teil des Kurses erarbeiten wir uns einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand sowie relevante begriffliche Instrumentarien, mithilfe derer wir uns dem Seminarthema verstehend annähern können. Im zweiten Teil erfolgt eine explorative Annäherung durch kleine Feldforschungsübungen im Rahmen der Nutzung und Entwicklung „intelligenter“ Tischoberflächen, wie sie derzeit im Forschungsprojekt VIGITIA an der Universität Regensburg entwickelt werden. Auf diese Weise schärfen wir unsere Perspektive sowie methodisch-analytische Kompetenzen und gewinnen nicht zuletzt einen Einblick in die interdisziplinäre Schnittstelle von Geistes- und Ingenieurswissenschaften.
- Trainer/in: Sarah Thanner
Mental Load heißt, an alles denken zu müssen, was die Familienorganisation betrifft. Arzttermine ausmachen, Kinderkleidung kaufen, an den Geburtstag denken - das alles kommt zu Haushalt, Kinderbetreuung und -erziehung noch dazu.
Eltern und Menschen, die Angehörige versorgen, sind schnell überlastet, vor allem, wenn sie berufstätig sind. Die mentale Überlastung betrifft besonders oft Frauen und führt nebenpsychischer Belastung auch zu finanziellen Nachteilen, raubt Ressourcen für Hobbys, verhindert Erholung und Selbstfürsorge und hat große Auswirkungen auf das Berufsleben.
Referentin: Laura Fröhlich, Referentin, Autorin, Journalistin, www.froehlichimtext.de
- Trainer/in: Katja Herrmann-Nadolski
- Trainer/in: Martha Hopper
Mentoring für alle Studierenden nach dem PD-Praktikum
Angebot des Austauschs und der Beratung nach dem PD-Praktikum für alle Arten des Lehramts
Das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum ist das erste universitäre Schulpraktikum im Lehramtsstudium. Es dient dazu, primäre Erfahrungen in der gewählten Schulart zu sammeln, die Entscheidung über das gewählte Studium zu stärken, den praktischen Bezug zum angeeigneten Wissen an der Universität herzustellen, bereits Erlerntes ausprobieren zu können und von der Rolle des Schülers, der Schülerin zur Rolle der Lehrkraft überzugehen.
Dies kann eine wunderbare Erfahrung sein, die sich motivierend auf den weiteren Verlauf des Studiums auswirkt. Allerdings kommt es auch immer wieder vor, dass das Praktikum nicht so verläuft, wie man es sich vorgestellt hat. Mögliche Gründe dafür können sein, dass man andere Erwartungen an das Praktikum oder die gewählte Schulart hatte, dass man merkt, sich für die falsche Altersgruppe entschieden zu haben, dass man sich überfordert oder von manchen Aufgaben überrumpelt fühlt und noch viele weitere.
Falls das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum deinen Erwartungen nicht gerecht werden konnte, du jetzt vielleicht sogar zweifelst, ob das von dir gewählte Studium die richtige Wahl ist, oder du dich einfach mit anderen und einer Lehrkraft mit praktischer Erfahrung darüber austauschen möchtest, gibt es folgendes Angebot: ein Treffen live oder via Zoom zum Austausch über die Erfahrungen, die im Praktikum gemacht wurden, über Ängste, Probleme, Kritik, Zweifel, Unerwartetes und neue Erkenntnisse. Gemeinsam überlegen wir uns dann notwendige Lösungswege. Hier wird Raum für alle offenen Fragen und Diskussion geboten.
Anmeldung in GRIPS (Mentoring PD Praktikum) erforderlich!
Kristina Steinbauer, Mittelschulmentorin
PraxisMentoring Lehramt Mittelschule
- Trainer/in: Kristina Steinbauer
Der Kurs "Methoden der VWL" is ein Pflichtkurs der ersten Studienphase im Studiengang Volkswirtschaftslehre.
In diesem Kurs werden die wesentlichen theoretischen und quantitativen Methoden der Volkswirtschaftslehre wiederholt und vertieft. Der erste Teil der Vorlesung beschäftigt sich mit Methoden der Optimierung. Dabei machen die Studierenden sich mit der Optimierung von Funktionen einer oder mehrerer Variablen vertraut. Anschließend diskutieren wir bindende und nicht-bindende Nebenbedingungen. Optimierungsprobleme lassen sich nicht immer von Hand lösen. Daher besteht ein weiterer zentraler Vorlesungsinhalt in der Vermittlung numerischer Methoden zur Lösung von Gleichungen und Gleichungssystemen. Schlussendlich erlernen wir Methoden er komparativen Statik. Konkret beschäftigen sich die Studierenden damit, wie sich der Zielfunktion und die Variablen eines Optimierungsproblems verändern, wenn Parameter der Optimierungsproblems variiert werden.
Der zweite Teil der Vorlesung beschäftigt sich mit der Modellierung der Veränderung von Variablen über die Zeit. Wir sprechen über Differenzen- und Differentialgleichungen und analysieren diese. Dabei steht die Steady State und Stabilitätsanalyse im Vordergrund. Darüber hinaus lernen wir Phänomene wie Zyklen und Chaos kennen.
- Trainer/in: Nicole Berr
- Trainer/in: Johannes Huber
- Trainer/in: Fabian Kindermann
- Trainer/in: Catharina Klüter
- Trainer/in: Sebastian Kunz
- Trainer/in: Theresia Stahl
Die Übung bietet einen Überblick über die wichtigsten Methoden und Medien des Arbeitslehre- Unterrichts (Fach Wirtschaft und Beruf an bayerischen Mittelschulen). Die Studierenden lernen die Unterrichtsmethoden und Medien in Theorie und Praxis kennen. Sie werden über Zielsetzungen und Inszenierungsformen der Methoden informiert, probieren sie zum Teil selbst aus und beschäftigen sich mit ihrem Einsatz im Unterrichtsfach Wirtschaft und Beruf. Wichtige Medien des Fachs werden vorgestellt und ihr Einsatz im Unterricht wird diskutiert.
Im Einzelnen erwerben die Studierenden folgende Kompetenzen:
- Sie können die theoretischen Grundlagen fachtypischer Methoden der Arbeitslehre erläutern und sind fähig, sie in konkreten Unterrichtsplanungen umzusetzen
- Sie können Medien beschreiben, die für den Einsatz im Unterrichtsfach Wirtschaft und Beruf geeignet sind und sind in der Lage, sie in Unterrichtsplanungen zu berücksichtigen
- Sie sind fähig, den Methoden- und Medieneinsatzes im Hinblick auf die Erreichung fachlicher und überfachlicher Bildungsziele der Arbeitslehre zu begründen und kritisch zu reflektieren
Leistungsnachweis: Unterrichtsplanung, verschiedene kleinere Übungsarbeiten
Das Seminar ist Teil des Basismoduls „Einführung in die Didaktik und Methodik des Lernbereichs Arbeit- Wirtschaft- Technik“ (3 LP).
- Trainer/in: Peter Herdegen
- Trainer/in: Philipp Artmann
- Trainer/in: Mirjam Dick
- Trainer/in: Christian Gegner
- Trainer/in: Katharina Gönczi
- Trainer/in: Anita Schilcher
- Trainer/in: Katharina Weikl
- Trainer/in: Sabrina Weiß
- Trainer/in: Pia Zilcher
Vorlesungsverzeichnis Nr.: 33 218
Zeit: Mo 10-12.15
Dauer: 3 Semesterwochenstunden
Turnus: wöchentlich
Beginn: 19.10.2009
Raum: ALFI 017
In dieser Übung werden wir uns mit den verschiedenen Migrationsbewegungen nach Regensburg beschäftigen, die das Leben in der Stadt seit 1945 bis in die unmittelbare Gegenwart geprägt haben bzw. prägen. In Kooperation mit dem Projekt des Stadtarchivs zu „Migration und memoria“ möchten wir mit Hilfe von biographischen Interviews die verschiedenen Migrationserfahrungen von Zuwanderern aus Ostmittel- und Südosteuropa und ihre Resonanz in Regensburg aufspüren. Dabei wird es insbesondere darum gehen, die Wirkungsmechanismen verschiedener Migrationserfahrungen auf die individuellen Biographien zu erfassen und individuell zu deuten. Als Vorbereitung auf die eigenständige Durchführung eines Interviews wird das Seminar die Möglichkeit bieten, methodologische und praktische Grundlagen der Interviewführung zu erwerben. Ein spezieller Fokus soll auf der lebensgeschichtlichen Interviewführung liegen, die sich in den letzten Jahren zu einem immer beliebteren Instrument qualitativer Geschichtsforschung entwickelt hat. Diese theoretischen und forschungspraktischen Kenntnissen werden die Studierenden im Laufe des Seminars dafür nutzen, ein eigenständiges Interviews mit einem Migranten/einer Migrantin vorzubereiten, durchzuführen und individuell zu interpretieren. Die in diesem Seminar gesammelten Erfahrungen und methodischen Kompetenzen ermöglichen Studierenden, diese auch über das Seminar hinaus (Forschung, Hörfunk, Journalismus) vielfältig zu nutzen.
- Trainer/in: Friederike Kind-Kovács
|
Die gesellschaftswissenschaftlichen Themen erfahren aktuell (noch) weniger Aufmerksamkeit in der Sachunterrichtsforschung, da derzeit die naturwissenschaftliche Grundbildung ‚en vogue’ ist. Themen, die Kinder für eine gelingende Teilhabe an der Gesellschaft befähigen, sollten dabei aber nicht aus den Augen verloren werden. Daher widmet sich dieses Seminar besonders den gesellschaftswissenschaftlichen und fächerübergreifenden Themen. Da das Rad nicht immer neu erfunden werden muss, lohnt der Blick in die Fachdidaktiken. |
Im Seminar werden fachgemäße Arbeitsweisen insbesondere bei den gesellschaftswissenschaftlichen Themengebieten theoretisch erarbeitet, praktisch erprobt und auf ihre Wirkweise auf den Kompetenzerwerb hin kritisch reflektiert.
- Trainer/in: Christian Gößinger
- Trainer/in: Marko Jovanovic
- Trainer/in: Adrian Linz
Die Werke des Dichters Geoffrey Chaucer (†1400) gehören zu den vergnüglichsten Texten der englischen Literaturgeschichte. Seine Sprache, der spätmittelenglische Dialekt der Hauptstadt London, weist bereits die Mischung von germanischen und romanischen Elementen auf, die das heutige Englisch charakterisiert, und ist mit etwas Übung genussvoll zu lesen. Anhand von Ausschnitten aus dem tragikomischen Liebesroman Troilus and Criseyde stellt dieser Kurs Schreibkonventionen, Aussprache, Wortschatz, Morphologie und Syntax des Mittelenglischen vor und arbeitet die wichtigsten Veränderungen zum Neuenglischen heraus.
Anforderungen für Erwerb von Leistungspunkten: Übungsaufgaben und Klausur.
Textgrundlage: W. Obst & F. Schleburg, Die Sprache Chaucers, Heidelberg 22010.
- Dozent: Florian Schleburg
Mit Mobilities hat John Urry ein
Feld der medien- und kulturwissenschaftlichen Forschung abgesteckt, auf dem
unterschiedliche Formen der Mobilität erkundet werden – von virtuellen
Bewegungen, die Medientechnologien wie Fernsehen oder Computerspiel ermöglichen, über die Mobilität tragbarer
Mediengeräte und einem davon bedingten Medienhandeln bis zu Aspekten der
Bewegung von Verkehrsmitteln und ihrem zum Teil massiven Einfluss auf unsere
Kultur. Mobilität und Medien will an diese weit reichende Definition von
Mobilität anschließen und sich mit kritischen Perspektiven auf die
Mobilitätskulturen und Autor:innen wie Mimi Sheller beziehen, unterschiedliche
Formen der Mobilität diskutieren, die Transformationen, die mit
Mobilkommunikation, Handy und Smartphone einhergehen und ihre Vorläufer untersuchen,
sowie sich mit medien- und kulturwissenschaftlichen Konzepten der Mobilität
beschäftigen, die mit Begriffen der ‚spaces of flows‘ (Castells), compact
culture oder einer flüssigen Moderne (Baumann) verbunden sind.
- erstellt von: Herbert Schwaab
Dass Wanderungsbewegungen gegenüber der Sesshaftigkeit der Normalfall sind, wird gern vernachlässigt; Geflüchtete, Arbeitsmigrant:innen Menschen mit Migrationsgeschichte und andere ‚Fremde‘ werden im Spannungsfeld aktueller Debatten häufig genug zu ihrem Nachteil (um-)gedeutet. Sie erfahren so eine Positionierung, die zumeist jenseits einer akteurszentrierten Herangehensweise liegt. Während Mobilität – etwa als soziale Mobilität im Sinne eines Aufstiegs oder als Reisen, Auslandsaufenthalte und andere Lifestylepraxen – gesellschaftlich eher eine positive Rahmung erfahren hat, wird Migration, insbesondere im politischen Diskurs, oft als herausfordernd oder sogar problembehaftet aufgefasst. Dabei sind beide Auslegungen zwei Seiten der gleichen Medaille. Im Kurs versuchen wir uns deshalb daran, die diese Bewegungen umgebenden Diskurse und Differenzierungen der Mehrörtigkeit durch diversitätssensible Perspektiven der kulturwissenschaftlichen Mobilitäts- und Migrationsforschung, etwa anhand des sozialkonstruktivistischen Doing Migration-Ansatzes (Vgl. u.a. Amelina 2017, S. 69), aufzubrechen und einzubetten sowie an eigenen Forschungen zu erproben.
Indem die Vergleichende Kulturwissenschaft eine gegenwartsorientierte, aber historisch fundierte Disziplin der Gesellschaftswissenschaften ist, werden sowohl aktuelle Fälle als auch solche aus der Zeitgeschichte einbezogen. Diese stammen vor allem aus dem mittel- und osteuropäischen Raum, sind aber nicht notwendigerweise darauf beschränkt.
Im Seminar werden zunächst zentrale Begriffe der kulturwissenschaftlichen Mobilitäts- und Migrations-Forschung geklärt sowie der Forschungsstand und seine (interdisziplinäre) Entwicklung diskutiert werden. Im Anschluss daran werden spezifische Fälle von Mobilität und Migration herausgearbeitet und analysiert, sodass neben einem breiten Panorama der Bewegungen auch methodologische und analytische Kompetenzen sowie der Blick für die Zusammenhänge zwischen lokalen, nationalen und globalen Entwicklungen geschult werden.
Literaturauswahl zur Seminarvorbereitung und -begleitung:
- Amelina, Anna. „3. Doing Migration und Doing Gender: Intersektionelle Perspektiven auf Migration und Geschlecht“. In: Lutz, Helma und Amelina, Anna (Hg.innen). Gender, Migration, Transnationalisierung: Eine intersektionelle Einführung, Bielefeld 2017, S. 67-90. https://doi.org/10.1515/9783839437964-005
- Bartels, Inken, Löhr, Isabella., Reinecke, Christiane, Schäfer, Philipp, & Stielike, Laura (Hg.): Umkämpfte Begriffe der Migration: Ein Inventar (Kultur und soziale Praxis). Bielefeld 2023. https://doi.org/10.14361/9783839457122
- Möhring, Maren. Jenseits des Integrationsparadigmas? Aktuelle Konzepte und Ansätze in der Migrationsforschung. Archiv für Sozialgeschichte. 2018. S. 305–330. https://library.fes.de/pdf-files/afs/bd58/afs58_20_moehring.pdf
- Möhring, Maren. Jenseits des Integrationsparadigmas? Teil II: Forschungen zur transnationalen Arbeitsmigration in Europa nach 1945. Archiv für Sozialgeschichte. 2019. S. 445–494. https://library.fes.de/pdf-files/afs/bd59/afs59_23_moehring.pdf
- Rolshoven, Johanna. Mobile Culture Studies – Kulturwissenschaftliche Mobilitätsforschung als Beitrag zu einer bewegungsorientierten Ethnographie der Gegenwart. In: Sonja Windmüller, Beate Binder, Thomas Hengartner (Hg.), Kultur-Forschung. Zum Profil einer volkskundlichen Kulturwissenschaft. Berlin 2009, S. 91-101.
- Schmidt-Lauber, Brigitta, und Manuel Liebig (Hg): Begriffe der Gegenwart. Ein kulturwissenschaftliches Glossar. Wien 2022, darin: Nimführ, Sarah: Asyl, S. 31-38; Sutter, Ove: Flüchtling, S. 99-106; Hess, Sabine: Migration, S. 187-194.; Sökefeld, Martin. Migrationshintergrund, S. 195-204. https://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.7767/9783205212744
- Welz, Gisela: Moving Targets. Feldforschung unter Mobilitätsdruck. In: Zeitschrift für Volkskunde. 94/1998, S. 177–194. https://www.digi-hub.de/viewer/image/DE-11-001938305/189/LOG_0049/
- Trainer/in: Jana Stöxen
Die Teilnehmenden sollen einen Einblick in die heute gängige Praxis des (Full-Stack) Webdevelopments mit der Programmiersprache JavaScript bekommen. JavaScript lässt sich heute zum Lösen von Problemen sowohl auf der Frontend-, als auch auf der Backend-Seite einsetzen. Ein wichtiger Meilenstein dabei war die Entwicklung von Node.js, das als Fundament für den Kurs dient. Aufbauend darauf, sollen die Teilnehmer:innen durch die Hilfe eines, den Kurs begleitenden Projektes (eine ToDo-App inkl. Authentifizierung) typische JavaScript-Werkzeuge kennenlernen:
- Express.js als Node-Framework zur Erstellung und Verwaltung der Applikation auf dem Server,
- MongoDB als Datenbank, die mit Hilfe von JSON arbeitet,
- EJS für einfaches Templating,
- React.js für die Umsetzung komplexerer Graphical User Interfaces.
- Trainer/in: Stefan Böhringer
- Trainer/in: Nils Constantin Hellwig
Mit der Etablierung von Buchdruck und Druckgraphik entstand in der Frühen Neuzeit auch die Sensationsberichterstattung, die als eine epochenübergreifende Konstante der medialen Nachrich-tenproduktion verstanden werden kann, auch wenn sie in der Frühen Neuzeit eigene Formen aufwies. Nach einer umfassenden Einführung in das Mediensystem der Frühen und Neuzeit und seine sozialen und ökonomischen Grundlagen wollen wir Einblattdrucke und Druckschriften zu sensationellen Vorkommnissen interpretieren, darunter Berichte über „Kannibalen“, „Missgebur-ten“, Naturkatastrophen oder auch Himmelszeichen. Dabei gab es auch in der Frühen Neuzeit schon „fake news“, die gleichwohl aufschlussreiche Informationen über die Medienproduzenten und ihre Ziele, Dynamiken des Mediensystems, aber auch über die Mentalitäten der Bevölkerung als Rezipienten solcher Drucke darstellen.
- Trainer/in: Harriet Rudolph
- Trainer/in: Maximilian Scholler
- Trainer/in: Andrea Stoeckl
Raum: CIP-Pool RZ3 (RZ 1.04)
Inhalt:
- Aktivität „Gruppenwahl“: G.R.I.P.S.-Kursteilnehmern die Möglichkeit geben, sich (z.B. zur Findung von Referatsgruppen) selbständig in Gruppen ein zu tragen.
- Aktivität „Aufgabe“: Abgabe von gestellten Aufgaben (Text und/oder Datei) über G.R.I.P.S.
- Aktivität „Test“ (Quizz): Erstellen von Fragen-Pools. Erstellen von Probe-Tests zur Klausurvorbereitung
- Offener Workshop zum Erfahrungsaustausch (Tipps and Tricks etc.)
- Trainer/in: Ulrike Allouche
- Trainer/in: Brigitte Doß
- Trainer/in: Ferdinand Kosak
- Trainer/in: Lisa Kugler
- Trainer/in: Julie Serre
- Trainer/in: Holger Striegl
Inhalt:
- Aktivität „Feedback“: Erstellung von anonymen oder nicht-anonymen Formularen um den Teilnehmern z.B. Feedback-Möglichkeiten zum Kurs zu geben.
- Aktivität „Aufgabe“: Abgabe von gestellten Aufgaben (Text und/oder Datei) über G.R.I.P.S.
- Aktivität „Test“ (Quizz): Erstellen von Fragen-Pools. Erstellen von Probe-Tests zur Klausurvorbereitung
- Aktivität „gerechte Verteilung“: G.R.I.P.S.-Kursteilnehmern die Möglichkeit geben, sich (z.B. zur Findung von Referatsgruppen) selbständig in Gruppen ein zu tragen.
- Offener Workshop zum Erfahrungsaustausch (Tipps und Tricks etc.)
- Trainer/in: Dominic Eric Delarue
- Trainer/in: Elvira Friebe
- Trainer/in: Uta Hasselmann
- Trainer/in: Tassilo Heinrich
- Trainer/in: Karin Reindl
- Trainer/in: Holger Striegl
Inhalt:
- Aktivität „Feedback“: Erstellung von anonymen oder nicht-anonymen Formularen um den Teilnehmern z.B. Feedback-Möglichkeiten zum Kurs zu geben.
- Aktivität „Aufgabe“: Abgabe von gestellten Aufgaben (Text und/oder Datei) über G.R.I.P.S.
- Aktivität „Test“ (Quizz): Erstellen von Fragen-Pools. Erstellen von Probe-Tests zur Klausurvorbereitung
- Aktivität „gerechte Verteilung“: G.R.I.P.S.-Kursteilnehmern die Möglichkeit geben, sich (z.B. zur Findung von Referatsgruppen) selbständig in Gruppen ein zu tragen.
- Offener Workshop zum Erfahrungsaustausch (Tipps und Tricks etc.)
- Trainer/in: Holger Striegl
Inhalt:
- Aktivität „Feedback“: Erstellung von anonymen oder nicht-anonymen Formularen um den Teilnehmern z.B. Feedback-Möglichkeiten zum Kurs zu geben.
- Aktivität „Aufgabe“: Abgabe von gestellten Aufgaben (Text und/oder Datei) über G.R.I.P.S.
- Aktivität „Test“ (Quizz): Erstellen von Fragen-Pools. Erstellen von Probe-Tests zur Klausurvorbereitung
- Aktivität „gerechte Verteilung“: G.R.I.P.S.-Kursteilnehmern die Möglichkeit geben, sich (z.B. zur Findung von Referatsgruppen) selbständig in Gruppen ein zu tragen.
- Offener Workshop zum Erfahrungsaustausch (Tipps und Tricks etc.)
- Trainer/in: Sylvia Kirchner-Luft
- Trainer/in: Laura Klauer
- Trainer/in: Holger Striegl
- Trainer/in: Anju Yu
Inhalt:
- Aktivität „Feedback“: Erstellung von anonymen oder nicht-anonymen Formularen um den Teilnehmern z.B. Feedback-Möglichkeiten zum Kurs zu geben.
- Aktivität „Aufgabe“: Abgabe von gestellten Aufgaben (Text und/oder Datei) über G.R.I.P.S.
- Aktivität „Test“ (Quizz): Erstellen von Fragen-Pools. Erstellen von Probe-Tests zur Klausurvorbereitung
- Aktivität „gerechte Verteilung“: G.R.I.P.S.-Kursteilnehmern die Möglichkeit geben, sich (z.B. zur Findung von Referatsgruppen) selbständig in Gruppen ein zu tragen.
- Offener Workshop zum Erfahrungsaustausch (Tipps und Tricks etc.)
- Trainer/in: Katja Felber
- Trainer/in: Alexander Lauf
- Trainer/in: Klaus Stiller
- Trainer/in: Holger Striegl
- Trainer/in: Test User01
Inhalt:
- Aktivität „Feedback“: Erstellung von anonymen oder nicht-anonymen Formularen um den Teilnehmern z.B. Feedback-Möglichkeiten zum Kurs zu geben.
- Aktivität „Aufgabe“: Abgabe von gestellten Aufgaben (Text und/oder Datei) über G.R.I.P.S.
- Aktivität „Test“ (Quizz): Erstellen von Fragen-Pools. Erstellen von Probe-Tests zur Klausurvorbereitung
- Aktivität „gerechte Verteilung“: G.R.I.P.S.-Kursteilnehmern die Möglichkeit geben, sich (z.B. zur Findung von Referatsgruppen) selbständig in Gruppen ein zu tragen.
- Offener Workshop zum Erfahrungsaustausch (Tipps und Tricks etc.)
- Trainer/in: Holger Striegl
Inhalt:
- Aktivität „Feedback“: Erstellung von anonymen oder nicht-anonymen Formularen um den Teilnehmern z.B. Feedback-Möglichkeiten zum Kurs zu geben.
- Aktivität „Aufgabe“: Abgabe von gestellten Aufgaben (Text und/oder Datei) über G.R.I.P.S.
- Aktivität „Test“ (Quizz): Erstellen von Fragen-Pools. Erstellen von Probe-Tests zur Klausurvorbereitung
- Aktivität „gerechte Verteilung“: G.R.I.P.S.-Kursteilnehmern die Möglichkeit geben, sich (z.B. zur Findung von Referatsgruppen) selbständig in Gruppen ein zu tragen.
- Offener Workshop zum Erfahrungsaustausch (Tipps und Tricks etc.)
- Trainer/in: Amy Gebauer
- Trainer/in: Katharina Herrmann
- Trainer/in: Dominik Herzner
- Trainer/in: Eileen Lägel-Gunga
- Trainer/in: Holger Striegl
Inhalt:
- Aktivität „Feedback“: Erstellung von anonymen oder nicht-anonymen Formularen um den Teilnehmern z.B. Feedback-Möglichkeiten zum Kurs zu geben.
- Aktivität „Aufgabe“: Abgabe von gestellten Aufgaben (Text und/oder Datei) über G.R.I.P.S.
- Aktivität „Test“ (Quizz): Erstellen von Fragen-Pools. Erstellen von Probe-Tests zur Klausurvorbereitung
- Aktivität „gerechte Verteilung“: G.R.I.P.S.-Kursteilnehmern die Möglichkeit geben, sich (z.B. zur Findung von Referatsgruppen) selbständig in Gruppen ein zu tragen.
- Offener Workshop zum Erfahrungsaustausch (Tipps und Tricks etc.)
- Trainer/in: Holger Striegl
Raum: CIP-Pool PT2 (PT 2.0.2)
Inhalt:
- Aktivität „Gruppenwahl“: G.R.I.P.S.-Kursteilnehmern die Möglichkeit geben, sich (z.B. zur Findung von Referatsgruppen) selbständig in Gruppen ein zu tragen.
- Aktivität „Aufgabe“: Abgabe von gestellten Aufgaben (Text und/oder Datei) über G.R.I.P.S.
- Aktivität „Test“ (Quizz): Erstellen von Fragen-Pools. Erstellen von Probe-Tests zur Klausurvorbereitung
- Offener Workshop zum Erfahrungsaustausch (Tipps and Tricks etc.)
- Trainer/in: Corinna Handschuh
- Trainer/in: Christina Knott
- Trainer/in: Lars Krenkel
- Trainer/in: Jan-Philipp Neetz
- Trainer/in: Christian Roth
- Trainer/in: Holger Striegl
- Trainer/in: Sonja Wörle
- Trainer/in: Eva Wrobel
- Trainer/in: Suzanne Zander
Inhalt:
- Aktivität „Feedback“: Erstellung von anonymen oder nicht-anonymen Formularen um den Teilnehmern z.B. Feedback-Möglichkeiten zum Kurs zu geben.
- Aktivität „Aufgabe“: Abgabe von gestellten Aufgaben (Text und/oder Datei) über G.R.I.P.S.
- Aktivität „Test“ (Quizz): Erstellen von Fragen-Pools. Erstellen von Probe-Tests zur Klausurvorbereitung
- Aktivität „gerechte Verteilung“: G.R.I.P.S.-Kursteilnehmern die Möglichkeit geben, sich (z.B. zur Findung von Referatsgruppen) selbständig in Gruppen ein zu tragen.
- Offener Workshop zum Erfahrungsaustausch (Tipps und Tricks etc.)
- Trainer/in: Holger Striegl
Inhalt:
- Aktivität „Feedback“: Erstellung von anonymen oder nicht-anonymen Formularen um den Teilnehmern z.B. Feedback-Möglichkeiten zum Kurs zu geben.
- Aktivität „Aufgabe“: Abgabe von gestellten Aufgaben (Text und/oder Datei) über G.R.I.P.S.
- Aktivität „Test“ (Quizz): Erstellen von Fragen-Pools. Erstellen von Probe-Tests zur Klausurvorbereitung
- Aktivität „gerechte Verteilung“: G.R.I.P.S.-Kursteilnehmern die Möglichkeit geben, sich (z.B. zur Findung von Referatsgruppen) selbständig in Gruppen ein zu tragen.
- Offener Workshop zum Erfahrungsaustausch (Tipps und Tricks etc.)
- Trainer/in: Holger Striegl
Raum: CIP-Pool PT2 (PT 2.0.2)
Inhalt:
- Aktivität „Gruppenwahl“: G.R.I.P.S.-Kursteilnehmern die Möglichkeit geben, sich (z.B. zur Findung von Referatsgruppen) selbständig in Gruppen ein zu tragen.
- Aktivität „Aufgabe“: Abgabe von gestellten Aufgaben (Text und/oder Datei) über G.R.I.P.S.
- Aktivität „Test“ (Quizz): Erstellen von Fragen-Pools. Erstellen von Probe-Tests zur Klausurvorbereitung
- Offener Workshop zum Erfahrungsaustausch (Tipps and Tricks etc.)
- Trainer/in: Sabine Fischer
- Trainer/in: Karin Reindl
- Trainer/in: Julie Serre
- Trainer/in: Holger Striegl
- Trainer/in: Test User03
- Trainer/in: Antje Zenker
Inhalt:
- Aktivität „Feedback“: Erstellung von anonymen oder nicht-anonymen Formularen um den Teilnehmern z.B. Feedback-Möglichkeiten zum Kurs zu geben.
- Aktivität „Aufgabe“: Abgabe von gestellten Aufgaben (Text und/oder Datei) über G.R.I.P.S.
- Aktivität „Test“ (Quizz): Erstellen von Fragen-Pools. Erstellen von Probe-Tests zur Klausurvorbereitung
- Aktivität „gerechte Verteilung“: G.R.I.P.S.-Kursteilnehmern die Möglichkeit geben, sich (z.B. zur Findung von Referatsgruppen) selbständig in Gruppen ein zu tragen.
- Offener Workshop zum Erfahrungsaustausch (Tipps und Tricks etc.)
- Trainer/in: Holger Striegl
Inhalt:
- Aktivität „Feedback“: Erstellung von anonymen oder nicht-anonymen Formularen um den Teilnehmern z.B. Feedback-Möglichkeiten zum Kurs zu geben.
- Aktivität „Aufgabe“: Abgabe von gestellten Aufgaben (Text und/oder Datei) über G.R.I.P.S.
- Aktivität „Test“ (Quizz): Erstellen von Fragen-Pools. Erstellen von Probe-Tests zur Klausurvorbereitung
- Aktivität „gerechte Verteilung“: G.R.I.P.S.-Kursteilnehmern die Möglichkeit geben, sich (z.B. zur Findung von Referatsgruppen) selbständig in Gruppen ein zu tragen.
- Offener Workshop zum Erfahrungsaustausch (Tipps und Tricks etc.)
- Trainer/in: Ramona Bosek
- Trainer/in: Nico Braun
- Trainer/in: Julia Buerger
- Trainer/in: Ekaterina Cardone
- Trainer/in: Carmen Jochem
- Trainer/in: Erich Renz
- Trainer/in: Yvonne Schmid
- Trainer/in: Holger Striegl
- Trainer/in: Test User06
Inhalt:
- Aktivität „Feedback“: Erstellung von anonymen oder nicht-anonymen Formularen um den Teilnehmern z.B. Feedback-Möglichkeiten zum Kurs zu geben.
- Aktivität „Aufgabe“: Abgabe von gestellten Aufgaben (Text und/oder Datei) über G.R.I.P.S.
- Aktivität „Test“ (Quizz): Erstellen von Fragen-Pools. Erstellen von Probe-Tests zur Klausurvorbereitung
- Aktivität „gerechte Verteilung“: G.R.I.P.S.-Kursteilnehmern die Möglichkeit geben, sich (z.B. zur Findung von Referatsgruppen) selbständig in Gruppen ein zu tragen.
- Offener Workshop zum Erfahrungsaustausch (Tipps und Tricks etc.)
- Trainer/in: Holger Striegl
Dieser Kurs soll in die Grundlagen der Morphologie und Syntax einführen. Wir werden uns zunächst mit der Morphologie beschäftigen und grundlegende Konzepte besprechen; dazu gehören die verschiedenen Wortarten (Nomen, Verben, Adjektive, etc.) und andere morphologische Einheiten. Im Anschluss sollen verschiedene Arten von Wortbildungsprozessen, also Flexion, Derivation und Komposition, vorgestellt werden; wir werden besprechen, wodurch sich diese Wortbildungsprozesse auszeichnen und auch, wie sich Derivation und Komposition sowie Flexion und Derivation voneinander abgrenzen lassen. Entsprechend sind das Verhältnis von Wörtern und Phrasen, aber auch die Produktivität morphologischer Prozesse weitere Themen dieses Kurses. Wir werden uns außerdem mit den Schnittstellen der Morphologie zur Phonologie und zur Syntax beschäftigen; Letzteres wird dann überleiten zum zweiten Teil des Kurses, der Einführung in die Syntax. Hier sollen zunächst syntaktische Funktionen (Subjekt, Prädikat, Objekt) erläutert werden, bevor grammatische Relationen und die Konstituentenstruktur besprochen werden; die letzten beiden Themen beschäftigen sich mit der Frage, wie syntaktische Funktionen markiert und innerhalb eines Satzes angeordnet werden können. Anschließend soll das Konzept der Dependenz erläutert werden; unter Dependenz versteht man die Abhängigkeit eines Elementes im Satz von einem anderen (wie etwa im Deutschen zwischen Adjektiv und Substantiv). Weitere Themen werden Strukturen der Verbalphrase sein: Valenz (also die Anzahl der Argumente des Verbs), die Markierung von Partizipanten sowie Tempus, Modus und Aspekt. Abschließend werden wir uns mit Möglichkeiten der Satzverknüpfung, der Koordination und der Subordination, auseinander setzen. Neben Beispielen aus dem Deutschen werden auch zahlreiche Beispiele aus nicht-indoeuropäischen Sprachen verwendet werden, so dass die Teilnehmer dieses Kurses einen Einblick in die Typologie morphologischer und syntaktischer Kategorien erhalten.
Mehrsprachigkeit ist nicht nur ein prägendes Merkmal des europäischen Gedankens, sondern ist schlichtweg mittlerweile auch zu einer gesellschaftlichen Realität geworden und hat in den letzten Jahren ein massives Forschungsinteresse geweckt, das sich gegenwärtig in einer großen Menge an Publikationen niederschlägt, in denen sich die Komplexität des Themas deutlich widerspiegelt: Mehrsprachigkeit ist Teil der Linguistik, indem sie Fragen nach Spracherwerbstheorien, Transfer- und Interferenzphänomen, Code-Switching usw. aufwirft, und ist zugleich in der Soziologie verankert, da sie einige gesellschaftliche Gruppen besonders prägt, darunter autochthone Minderheiten (Dänisch, Friesisch, Saterfriesisch, Ober-/Niedersorbisch) ebenso wie Personen mit Migrationshintergrund. Daran schließt sich die Frage an, wie klassische mehrsprachige Nationen – Schweiz, Spanien oder Kanada – dieser Sachlage politisch begegnen. Auch die EU trägt deutliche Züge eines Projekts der Mehrsprachigkeit. Immer deutlicher wird auch die Rolle von Multikulturalität und damit von Sprachlichkeit für den Erfolg von Wirtschaftsunternehmen. Wie eine Gesellschaft mit Mehrsprachigkeit umgeht, zeigt sich weiterhin im medialen Umgang damit, der sich vor allem im 20. Jh. im Werk von mehrsprachigen Schriftstellern widerspiegelt. Nicht zu vergessen sind zudem die didaktischen Dimensionen von Mehrsprachigkeit, und dies ebenso bereits im Elternhaus, im Vorschulalter wie während der schulischen Ausbildung.
Die Vorlesung soll einen Überblick über all diese Bereiche sowie grundlegende theoretische Konzepte und praktische Beispiele vermitteln.
Zur vorbereitenden Lektüre sei empfohlen:
Busch, Brigitta, Mehrsprachigkeit, Stuttgart: UTB, 2013.
Müller, Natascha; Kupisch, Tanja; Schmitz, Katrin; Cantone, Katja, Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung, Tübingen: Narr, 2011.
Leistungspunkte: je nach Modulbeschreibung |
Klausur oder ggf. Hausarbeit |
Zielgruppe: Studierende aller romanistischen Studiengänge; Studierende im Zusatzstudium Mehrsprachigkeitsberatung, Studierende des Masterstudiengangs MaMuR.
- Trainer/in: Info Msb
Mehrsprachigkeit ist nicht nur ein prägendes Merkmal des europäischen Gedankens, sondern ist schlichtweg mittlerweile auch zu einer gesellschaftlichen Realität geworden und hat in den letzten Jahren ein massives Forschungsinteresse geweckt, das sich gegenwärtig in einer großen Menge an Publikationen niederschlägt, in denen sich die Komplexität des Themas deutlich widerspiegelt: Mehrsprachigkeit ist Teil der Linguistik, indem sie Fragen nach Spracherwerbstheorien, Transfer- und Interferenzphänomen, Code-Switching usw. aufwirft, und ist zugleich in der Soziologie verankert, da sie einige gesellschaftliche Gruppen besonders prägt, darunter autochthone Minderheiten (Dänisch, Friesisch, Saterfriesisch, Ober-/Niedersorbisch) ebenso wie Personen mit Migrationshintergrund. Daran schließt sich die Frage an, wie klassische mehrsprachige Nationen – Schweiz, Spanien oder Kanada – dieser Sachlage politisch begegnen. Auch die EU trägt deutliche Züge eines Projekts der Mehrsprachigkeit. Immer deutlicher wird auch die Rolle von Multikulturalität und damit von Sprachlichkeit für den Erfolg von Wirtschaftsunternehmen. Wie eine Gesellschaft mit Mehrsprachigkeit umgeht, zeigt sich weiterhin im medialen Umgang damit, der sich vor allem im 20. Jh. im Werk von mehrsprachigen Schriftstellern widerspiegelt. Nicht zu vergessen sind zudem die didaktischen Dimensionen von Mehrsprachigkeit, und dies ebenso bereits im Elternhaus, im Vorschulalter wie während der schulischen Ausbildung.
Die Vorlesung soll einen Überblick über all diese Bereiche sowie grundlegende theoretische Konzepte und praktische Beispiele vermitteln.
Zur vorbereitenden Lektüre sei empfohlen:
Busch, Brigitta, Mehrsprachigkeit, Stuttgart: UTB, 2013.
Müller, Natascha; Kupisch, Tanja; Schmitz, Katrin; Cantone, Katja, Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung, Tübingen: Narr, 2011.
Leistungspunkte: je nach Modulbeschreibung |
Klausur oder ggf. Hausarbeit |
Zielgruppe: Studierende aller romanistischen Studiengänge; Studierende im Zusatzstudium Mehrsprachigkeitsberatung, Studierende des Masterstudiengangs MaMuR.
- Trainer/in: Nicole Eller-Wildfeuer
- Trainer/in: Björn Hansen
- Trainer/in: Rupert Hochholzer
- Trainer/in: Ralf Junkerjürgen
- Trainer/in: Jakob Leimgruber
- Trainer/in: Info Msb
- Trainer/in: Marek Nekula
- Trainer/in: Paul Rössler
- Trainer/in: Maria Selig
- Trainer/in: Carola Surkamp
Die mittelalterliche Kultur ist in vielfältiger Hinsicht von ganz
unterschiedlichen, agonalen Kommunikationsformen geprägt, die in einem
mehr oder weniger öffentlichen Raum stattfinden konnten:
Streitgespräche, Disputationen, Spott- und Provokationsreden, aber auch
Lehrgespräche oder Selbstgespräche, die wie Gespräche mit einem
Gegenüber (dem ‚Anderen‘) konzipiert sind. In diesen Dialogformen finden
sich kulturelle, religiöse, geschlechtliche und soziale Differenzen
reflektiert: Es geht um Fragen von Macht und Autorität, um
(Glaubens-)Wahrheit und Identität. Interessant sind gerade die Formen
der Dialogizität, die wie Wettkämpfe konzipiert sind, in denen konträre
Ansichten über das Wahre, das Richtige etc. einander gegenübergestellt
werden. Denn wer hat letztlich die Deutungshoheit? Wie generieren ganz
unterschiedliche Textgattungen Überzeugungen? Wie wird argumentiert und
mit Worten gestritten? Mittels Wunderwirken und Zweikämpfen wird die
Argumentation mitunter ohne Worte beendet.
Anhand zweier ‚Autoren‘ fragen wir nach potentiellen Regeln und
Strategien dieser Kommunikationsformen. Zum einen steht das Werk
Hartmanns von Aue im Mittelpunkt, insbesondere der Artusroman ‚Iwein‘
und die höfischen Legenden ‚Gregorius‘ und ‚Der Arme Heinrich‘. Zum
anderen wird das in etwa zeitgenössische Mirakelbuch des Zisterziensers
Cäsarius von Heisterbach in den Blick genommen, das als Lehrdialog
zwischen einem Novizen und seinem Meister konzipiert ist (‚Dialog über
die Wunder‘), aber auch intern zahlreiche agonale Gesprächssituationen
wiedergibt.
Von der gemeinsamen Textarbeit von Literaturwissenschaftler*innen und
Historiker*innen sowie von den geplanten Stadtspaziergängen in
Regensburg und Erlangen/Nürnberg versprechen sich die beiden Lehrenden
eine produktive Diskussionsatmosphäre, die neue Sichtweisen auf Texte
und Kontexte des 13. Jahrhunderts erlaubt.
- Trainer/in: Jörg Oberste
- Trainer/in: Tobias Spiel
(kommt noch)
- Trainer/in: Anton Alesik
- Trainer/in: Jakob Fehle
- Trainer/in: Sabrina Hößl
- Trainer/in: Andreas Schmid
- Trainer/in: Raphael Wimmer
- Trainer/in: Laura Zeilbeck
(kommt noch)
- Trainer/in: Anton Alesik
- Trainer/in: Jakob Fehle
- Trainer/in: Sabrina Hößl
- Trainer/in: Raphael Wimmer
(kommt noch)
- Trainer/in: Niklas Donhauser
- Trainer/in: Jakob Fehle
- Trainer/in: Sabrina Hößl
- Trainer/in: Andreas Schmid
- Trainer/in: Raphael Wimmer
(kommt noch)
- Trainer/in: Niklas Donhauser
- Trainer/in: Jakob Fehle
- Trainer/in: Sabrina Hößl
- Trainer/in: Andreas Schmid
- Trainer/in: Raphael Wimmer
- Trainer/in: Kathrin Hausmann-Balk
- Trainer/in: Friederike Pronold-Günthner
Hier finden Sie den Grips-Kurs des Seminars "Mündliche Kommunikation" im Deutschunterricht
| Kommentar | The course is based on the holistic approach of the Orff Schulwerk. An introduction into the main ideas of the Orff approach will be introduced and how they can be used in general as well as music classroom with children. One of the main aims is to tune into the students creative capacity, giving stimuli and room for creativity by singing, movement and playing – an opportunity to learn together and from others in a group where the level of skill and motivation varies. At the end of the course, students should have:
|
|---|---|
| Literatur | Nordic sounds. Educational material for music and dance: https://www.nordicsounds.info/app/#/0/start Hermann Regner (1977): Music for children. Orff Schulwerk, American Edition. Bases on Carl Orff and Gunild Keetmann. Mainz: Schott.Doug Goodkin. (2002). Play, Sing & Dance: An Introduction to Orff Schulwerk. Schott: Miami. See here: https://www.amazon.com/Play-Sing-Dance-Introduction-Schulwerk/dp/190245507X
|
- Trainer/in: Magnus Gaul
- Trainer/in: Kristin Valsdóttir
Das Seminar widmet sich der mehrstimmigen Musik in Verbindung mit der Totenliturgie im Europa der Frühen Neuzeit. Ansatzpunkt ist die Auseinandersetzung mit verschiedenen Kontexten des Musizierens während der Totenliturgie (Totenmesse, Totenoffizium, Absolutio, Votiv- und Trauerprozessionen) anhand liturgischer sowie chronikalischer Quellen. Anhand von Werkanalysen verschiedener Traditionen (vor allem Spaniens und Italiens) werden die Merkmale des polyphonen Repertoires behandelt. Die Verbindung musikalischer und historischer Quellen wird uns durch eine Renaissance-Trauerfeier und deren Soundscapes führen. Im Seminar wollen wir versuchen, die Musik für ausgewählte Exequien zu rekonstruieren.
Darüber hinaus werden auch paraliturgische Stücke wie Trauermotetten und Déplorations auf den Tod von politischen, religiösen und künstlerischen Persönlichkeiten betrachtet. Hier stehen Unterschiede zum liturgischen Repertoire hinsichtlich Struktur, Kompositionstechniken und Ethos im Mittelpunkt. Im Zusammenhang damit sollen auch Werke späterer Komponisten wie William Byrd, Heinrich Schütz und Dietrich Buxtehude zum Vergleich herangezogen werden.
Praktische Erfahrungen mit liturgischen und musikalischen Quellen werden in der Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg gesammelt, die dem Seminar zahlreiche relevante Quellen zur Verfügung stellt (u.a. Handschriften mit Requiem-Messen von Jean Richafort und Blasius Amon sowie viele liturgische Quellen).
- Trainer/in: Antonio Chemotti
| Kurzkommentar |
Musikbezogene und interdisziplinäre Zugänge zu einer der wichtigsten menschlichen Ressourcen |
|---|---|
| Kommentar |
Der Umgang mit der Zeit ist nicht nur eine Frage des Musikunterrichts. Er gehört zu den wichtigsten Kernkompetenzen in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Zeit zu haben oder sich Zeit zu nehmen, erweist sich mehr und mehr als Herausforderung. Denn die schulischen Aktivitäten und die Freizeitgestaltung unterliegen zunehmend einer Fülle terminlicher Angebote, die aufgrund ihrer Vielfalt nur zum Teil effektiv genutzt werden können. Der individuelle Umgang mit digitalen Medien erschwert bei Kindern und uns Erwachsenen zudem, in vielen Situationen zeitliche Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Verantwortungsvolles Lernen im Kontext Bildung und Erziehung kann jedoch nur effektiv gelingen, wenn dafür Zeit und Ruhe zur Verfügung stehen und Bildungsprozesse nicht ausschließlich unter Zeitdruck angeleitet werden. Die Lehrveranstaltung ist als Ringvorlesung konzipiert (Präsenztermine und digital), zu der in jeder Woche ein neuer Referent eingeladen ist. Sie möchte dazu beitragen, den Umgang mit der Zeit bei Kindern und Jugendlichen konkreter zu analysieren, um – musikbezogen und interdisziplinär – Wege aufzuzeigen, wie mit der wichtigen Ressource Zeit umgegangen werden kann. Dazu werden in interdisziplinärer Sichtweise Strategien entwickelt, die einen effektiven Umgang mit der Zeit vorschlagen. Diese praxisorientierte Sichtweise, die sich aus der Bildenden Kunst, der Musik, dem Sport, der Medizin, der Medienerziehung sowie anderen pädagogischen Lebensbereichen nährt, wird einen Einblick zulassen in die Vielschichtigkeit und den hohen erzieherischen Wert der Thematik. Die Veranstaltung findet z.T. digital statt, ein anderer Teil als Präsenzveranstaltung. Um Anmeldung über das Sekretariat wird gebeten. Der Hörsaal wird über die Interseite des Lehrstuhls für Musikpädagogik bekannt gegeben und über
|
| Literatur |
Wittmann, M. (2016): Felt Time. The Psychology of How We Perceive Time. MIT Press. |
- Trainer/in: Magnus Gaul
Die Musikgeschichtsvorlesung MG4/Horn behandelt im Wesentlichen das Zeitalter der "Sonatenzyklen" von der Cembalosonate über die Kammermusik bis hin zur Symphonie.
Der Zeitraum reicht von etwa 1750 und reicht bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Bitte geben Sie bei den Modulprüfungen jeweils an, bei wem Sie eine bestimmte
Vorlesung gehört haben, damit Sie von der "richtigen Person" über die richtige Vorlesung geprüft werden.
In Grips werde ich bevorzugt leicht kommentiertes Notenmaterial hochladen. Bitte machen Sie sich während einer Doppelstunde Notizen, die es Ihnen später erlauben, den
Sinn der Materialien noch zu erkennen. Und ganz wichtig: RECHERCHIEREN SIE AUSGEHEND VON DEN MATERIALIEN eigenständig weiter, bis Sie einen Kontext formuliert haben,
mit dem Sie zufrieden sind.
- Trainer/in: Bettina Berlinghoff-Eichler
- Trainer/in: Wolfgang Horn
|
Einführung in die Musikpsychologie und ihre Forschungsmethoden, Mythen der Musikwirkung; Psychoakustische Grundlagenforschung: Frequenzgruppe, Schwebung vs. Rauigkeit, Differenztöne und virtuelle Tonhöhe, Glockenton, Shepard Scale; phon- und sone-Skala, Maskierung, Fusionsschwelle, Raumhören; psychoakustisches Modell und MP3; Konsonanztheorien, Wahrnehmung des Dreiklangs, Auswirkungen dieser Ergebnisse auf Komposition, Orchestrierung, Musikproduktion etc., virtuelle Akustik; Schumannsche Klangfarbengesetze und andere klangbestimmende Merkmale von Musikinstrumenten: Ein-, Ausschwing- und Übergangsvorgänge, Modulationen, Geräuschanteile, Timbre Space; Gruppierungsmechanismen beim Hören:Prinzipien von Wertheimer, Bedeutung der Spektralkomponenten, der Synchronizität des Toneinsatzes und die Rolle der räumlichen Position; Gruppierung bei Tonfolgen; „chunks“, Tonleiter- und Oktaventäuschung von Deutsch; Ähnlichkeits-Algorhythmen und Plagiate; Musikalische Begabung, Musikalitätstests und Assessment: Komponenten musikalischer Fähigkeit, Klassifikation von Musikalitätstests, Testgütekriterien, kurze Beschreibung eines „klassischen Tests“ Überblick über die neuere Testentwicklung: Wiener Test für Musikalität (WTM); Profile of Music Perception Skills (PROMS); Beurteilung musikalischer Performanz, Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM), Jazz BigBand Performance Rating Scale; Mormgerechter musikalischer Entwicklungsstand bei 5jährigen Kindern; Elementare Musikpädagogik; Entwicklung des Singens, der Melodie- Klangfarben-, Harmonie-, Tonalitäts-, Rhythmuswahrnehmung und Rhythmusproduktion; Problematik der „Brummer“ (verschiedene Typen); Musikalische Sonderleistungen (Speialbegabungen): Absolutes Gehör, Erklärungsansätze, Online-Tests, Wunderkinder und Idiots Savants, Synästhesien, das Phänomen der „Ohrwürmer“, Involuntary Musical Imagery Scale (IMIS);Theorien zur Psychologie des Übens und des Vom-Blatt-Spiels (-Singens): Fertigkeitserwerb und –entwicklung, Deliberate practice-Ansatz vs.Talent-/ Begabungsansatz, positive Übungsumgebung, mentales Training; neurowissenschaftliche Befunde zum Effekt musikalischer Übung; Vom-Blatt-Spiel: Gedächtnismodell von Baddeley; Visuelle Wahrnehmung und Augenbewegungen, Auge-Hand-Spanne, Gedächtnisprozesse, Mustererkennen, Fingersätze, Trainierbarkeit; Musiker und ihre Persönlichkeit: Persönlichkeitsmessung („Big Five“ oder Persönlichkeits-Faktoren-Inventar von Cattell); Faktoren-Analyse als Forschungsmethode; Persönlichkeitsunterschiede zwischen Instrumentalisten; Persönlichkeit des kreativen Musikers (Komponist-Improvisator); Entwicklung musikalisch-generativer Fähigkeiten; musikalische Improvisation in der Schule;Musik und Emotion: Physiologische Reaktionen auf Musik (Herzrate, Hautwiderstand, Atmung etc.), Methoden zur Messung von Emotionen (u.a. Hevnerscher Adjektivzirkel, semantisches Differential), Chills, Repräsentation und Induktion von Emotionen; Emotionstheorien von James-Lange, Cannon, Schachter-Singer, Lazarus, Mandler im Überblick; Techniken der expressiven Gestaltung und Ausdruck von Emotion im musikalischen Vortrag; empirische Interpretationsforschung; Affektenlehre; Lampenfieber und Musikerkrankheiten: Erklärungsansätze zur Genese; Methoden der Angstbewältigung; Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit und Selbstdarstellung; Somatische, neurologische und psychische Krankheiten bei Musikern: Prävention und Behandlung; Musik in der Therapie und Hypnose:Überblick über verschiedene Therapieansätze und das Methodeninventar; Rolle der Musik in der Therapie; Praxisfelder der Therapie; Musiktherapeutische Anwendungen in der Regelschule Aktuelle Forschungsergebnisse, häufig angewandte Forschungsmethoden und die Möglichkeiten für eine schulische Aufbereitung der Themen werden miteinbezogen. Das Seminar hat prüfungsvorbereitende Qualität. Erwerb der Modulpunkte durch regelmäßige, aktive Teilnahme und Kurzreferat mit empirischem Anteil. Für Studierende des Lehramts GY mit Musik als Doppelfach besteht im Anschluss die Möglichkeit, die Modulteilprüfung „Musikpsychologie" [GYD-025.2] abzulegen – mit Extra-Anmeldung.
|
|
| Literatur |
Lehmann/Kopiez (Hg.): Handbuch Musikpsychologie, Bern 2018; Stoffer/Oerter (Hg.): Allgemeine Musikpsychologie, Hogrefe Göttingen 2005; Oerter/Stoffer (Hg.): Spezielle Musikpsychologie, Hogrefe Göttingen 2005; Motte-Haber/Rötter (Hg.): Musikpsychologie, Laaber 2005; Bruhn/Rösing (Hg.): Musikpsychologie in der Schule, Augsburg 2 2003. |
|---|---|
| Zielgruppe |
UGS, UHS, URS, GYV, GYD, bei Kapazität interessierte Studierende aus den Bereichen K und D |
- Trainer/in: Hans Pritschet
Einführung in die Musikpsychologie und ihre Forschungsmethoden, Mythen der Musikwirkung; Psychoakustische Grundlagenforschung: Frequenzgruppe, Schwebung vs. Rauigkeit, Differenztöne und virtuelle Tonhöhe, Glockenton, Shepard Scale; phon- und sone-Skala, Maskierung, Fusionsschwelle, Raumhören; psychoakustisches Modell und MP3; Konsonanztheorien, Wahrnehmung des Dreiklangs, Auswirkungen dieser Ergebnisse auf Komposition, Orchestrierung, Musikproduktion etc., virtuelle Akustik; Schumannsche Klangfarbengesetze und andere klangbestimmende Merkmale von Musikinstrumenten: Ein-, Ausschwing- und Übergangsvorgänge, Modulationen, Geräuschanteile, Timbre Space; Gruppierungsmechanismen beim Hören:Prinzipien von Wertheimer, Bedeutung der Spektralkomponenten, der Synchronizität des Toneinsatzes und die Rolle der räumlichen Position; Gruppierung bei Tonfolgen; „chunks”, Tonleiter- und Oktaventäuschung von Deutsch; Ähnlichkeits-Algorhythmen und Plagiate; Musikalische Begabung, Musikalitätstests und Assessment: Komponenten musikalischer Fähigkeit, Klassifikation von Musikalitätstests, Testgütekriterien, kurze Beschreibung eines „klassischen Tests” Überblick über die neuere Testentwicklung: Wiener Test für Musikalität (WTM); Profile of Music Perception Skills (PROMS); Beurteilung musikalischer Performanz, Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM), Jazz BigBand Performance Rating Scale; Musikalische Sonderleistungen (Speialbegabungen): Absolutes Gehör, Erklärungsansätze, Online-Tests, Wunderkinder und Idiots Savants, Synästhesien, das Phänomen der „Ohrwürmer”, Involuntary Musical Imagery Scale (IMIS);Theorien zur Psychologie des Übens und des Vom-Blatt-Spiels (-Singens): Fertigkeitserwerb und –entwicklung, Deliberate practice-Ansatz vs.Talent-/ Begabungsansatz, positive Übungsumgebung, mentales Training; neurowissenschaftliche Befunde zum Effekt musikalischer Übung; Vom-Blatt-Spiel: Gedächtnismodell von Baddeley; Visuelle Wahrnehmung und Augenbewegungen, Auge-Hand-Spanne, Gedächtnisprozesse, Mustererkennen, Fingersätze, Trainierbarkeit;Musik und Emotion: Physiologische Reaktionen auf Musik (Herzrate, Hautwiderstand, Atmung etc.), Methoden zur Messung von Emotionen (u.a. Hevnerscher Adjektivzirkel, semantisches Differential), Chills, Repräsentation und Induktion von Emotionen; Emotionstheorien von James-Lange, Cannon, Schachter-Singer, Lazarus, Mandler im Überblick; Techniken der expressiven Gestaltung und Ausdruck von Emotion im musikalischen Vortrag; empirische Interpretationsforschung; Affektenlehre; Lampenfieber und Musikerkrankheiten:
Erklärungsansätze zur Genese; Methoden der Angstbewältigung; Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit und Selbstdarstellung; Somatische, neurologische und psychische Krankheiten bei Musikern: Prävention und Behandlung; Musik in der Therapie und Hypnose:Überblick über verschiedene Therapieansätze und das Methodeninventar; Rolle der Musik in der Therapie; Praxisfelder der Therapie; Musiktherapeutische Anwendungen in der Regelschule
Aktuelle Forschungsergebnisse, häufig angewandte Forschungsmethoden und die Möglichkeiten für eine schulische Aufbereitung der Themen werden miteinbezogen. Das Seminar hat prüfungsvorbereitende Qualität. Erwerb der Modulpunkte durch regelmäßige, aktive Teilnahme und Kurzreferat mit empirischem Anteil. Für Studierende des Lehramts GY mit Musik als Doppelfach besteht im Anschluss die Möglichkeit, die Modulteilprüfung „Musikpsychologie" [GYD-025.2] abzulegen – mit Extra-Anmeldung.
- Trainer/in: Hans Pritschet
Die Übung beschäftigt sich mit dem Körper als Forschungsgegenstand der Sozial- und Kulturgeschichte. Naturismus meint eine Nacktkultur, welche Anfang des 20. Jahrhunderts insbesondere von Deutschen im Zuge der Hinwendung zum Körperlichen durch Sport, Wandern und andere Freizeitgestaltung in der Natur als ein alternativer Lebensstil praktiziert wurde. Am Beispiel des Naturismus wird der nackte Körper als ein Medium der Subjektivierung wie Objektivierung, als Ort gesellschaftlicher Ordnungs- bzw. Abweichungsversuche und nicht zuletzt als Spiegel politischer Konflikte reflektiert. Der Naturismus wurde im Zuge der Lebensreformbewegungen als Weg zur Befreiung und Gesundung von Körper und Geist verstanden. Da die Nacktkultur sowohl in sozialreformerischen und marxistischen als auch in völkisch-rechtsradikalen sowie in unpolitischen und kommerziellen Strömungen Niederschlag fand, kann die Übung die Studierenden für Widersprüche und Ambiguitäten sensibilisieren. Der zeitliche Schwerpunkt der Übung liegt auf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, reicht aber aufgrund der Einbeziehung der Freikörperkultur (FKK) in der DDR auch bis in dessen zweite Hälfte.
- Trainer/in: Jacqueline Niesser
Willkommen zur Vorlesung "Nanobioanalytik"
- Trainer/in: Hans-Heiner Gorris
Seminarbeschreibung: In diesem Seminar erarbeiten wir projektorientiert die narrative Ausgestaltung der Stadt Regensburg. Das Seminar führt in einschlägige Theorien zum Raum und dessen narrativer Darstellung ein. Gemeinsam wird dann ein Korpus aus Erzähltexten aufgebaut, in denen die Stadt Regensburg vorkommt. Mithilfe digitaler Methoden aus dem Bereich Textmining und Geovisualisierung untersuchen wir anhand dieses Korpus welche kulturellen Besonderheiten mit der Stadt Regensburg verknüpft werden. Schließlich werden die Teilnehmenden des Seminars in Projektarbeiten, die sowohl forschungs- als auch praxisorientiert sein können ein Teilkorpus oder einen Themenbereich genauer betrachten und aufbereiten.
- Trainer/in: Mareike Schumacher
- Trainer/in: Daria Podwika
„Warum ist der Kürbis eine Beere?“
„Wie fressen eigentlich Schnecken ohne Zähne?“
Um zu Erkenntnissen zu gelangen und damit diese und andere Fragen zu beantworten sowie Phänomene zu erklären, ziehen Biologen für ihre Disziplin charakteristische Arbeitsweisen heran. Dabei gibt es nicht die eine naturwissenschaftliche Arbeitsweise – was SchülerInnen jedoch häufig denken – sondern je nach Gegenstand und Fragestellung muss eine geeignete Methode gewählt werden.
Wie Sie naturwissenschaftliche Arbeitsweisen (z.B. Sammeln, Vergleichen, Beobachten, Untersuchen, Experimentieren, etc.) in Ihrem Unterricht einsetzen, Ihre SchülerInnen damit vertraut machen und zur Erklärung biologischer Phänomene bzw. zur Beantwortung biologischer Fragestellungen einsetzen können, werden wir im Seminar erarbeiten.
Zum Thema „Erklären“ arbeiten wir außerdem im Rahmen des Projekts FALKE (Fachspezifische Lehrerkompetenzen im Erklären) an ausgewählten Terminen mit einem Seminar der Deutschdidaktik (Dozentin: Frau Lisa Gaier) zusammen.
Dabei bekommen Sie die Gelegenheit fachfremden Studierenden ein biologisches Phänomen zu erklären und kriteriengeleitetes Feedback zu erhalten, um Ihre Erklärkompetenz zu verbessern.
- Trainer/in: Christina Ehras
Forum für das Netzwerk Mutterschaft/Elternschaft und Wissenschaft: Kommt dazu und tauscht euch auch zwischen unseren Treffen aus! Wir freuen uns auf euch!

- Trainer/in: Jennifer Lehmann
- Trainer/in: Anna-Theresa Wolferstetter
In diesem Seminar werden ausgewählte Texte aus allen Bereichen der theoretischen Philosophie (und benachbarter Gebiete) gelesen und diskutiert. Es bietet Studierenden Gelegenheit, ihre eigenen philosophischen Interessen und Gedanken, die typischerweise im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer größeren Arbeit stehen (aber nicht stehen müssen), zur Diskussion zu stellen. Hierzu werden bevorzugt selbstverfasste Texte vorgelegt, es können aber auch geeignete Texte aus der Fachliteratur vorgeschlagen werden.
Eine thematische Vorfestlegung gibt es nicht. Ein detailliertes Programm wird in der ersten Sitzung festgelegt.
Leistungsnachweis
Übernahme eines Themas mit eigener schriftlicher Textvorlage. Die Textvorlagen sollen jeweils bereits einige Tage vor den Sitzungen vorliegen, in denen das vorgestellte Thema besprochen wird.
Voraussetzung
Für Studierende des BA Philosophie (Prüfungsordnung 2019) sind Vorkenntnisse in Philosophie (Module PHI-101, PHI-102, PHI-103, PHI-104, PHI-111, PHI-112 und PHI-113) verpflichtend.
Zielgruppe
Das Oberseminar richtet sich an engagierte und/oder fortgeschrittene Studierende der Philosophie. Für Bachelor-Studierende (PO 2008) zählt es als "Bachelorseminar", für Bachelor-Studierende (PO 2019) als "Oberseminar" und für Master-Studierende als "Masterseminar". Auch Doktorand*innen und Habilitand*innen sind herzlich willkommen. Studierende anderer Fächer können ggf. nach Rücksprache mit dem Seminarleiter teilnehmen.
- Trainer/in: Hans Rott
- Dieser GRIPS Kurs dient der Kommunikation mit den Personen am Campus Regensburg, die EvaExam einsetzen wollen.
- Zudem soll hier eine System-Doku und Best-Practice-Beispiele abgelegt werden.
- Weiterhin soll der Kurs dem Austausch der User untereinander dienen.
Eine Selbsteinschreibung in diesen Kurs ist nicht möglich. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: holger.striegl@ur.de
- Trainer/in: Marc Kouadio
- Trainer/in: Holger Striegl
- Trainer/in: Christopher Bartenschlager
- Trainer/in: Robert Bauer
- Trainer/in: Senta Betz
- Trainer/in: Fabian Daiß
- Trainer/in: Miro Ebert
- Trainer/in: Uta Engels
- Trainer/in: Jana Gaede
- Trainer/in: Bianca Günther
- Trainer/in: Jelena Haugg
- Trainer/in: Philipp Hofmann
- Trainer/in: Sabine Hoja
- Trainer/in: Petra Jansen
- Trainer/in: Sekretariat Jansen
- Trainer/in: Leonardo Jost
- Trainer/in: Florian Krätzig
- Trainer/in: Lea Krolikowski
- Trainer/in: Jennifer Lehmann
- Trainer/in: Carla Luttmann
- Trainer/in: Maria Meisel
- Trainer/in: Angelika Mundigl
- Trainer/in: Stefanie Pietsch
- Trainer/in: Christiane Portele
- Trainer/in: Clara Scheer
- Trainer/in: Franziska Schroter
- Trainer/in: Jitka Veldema
- Trainer/in: Annica Winkelmair
- Trainer/in: Susanne Ziereis
Die Stadt Petersburg erscheint in den Werken Nikolaj Gogols (1809-1852) nicht nur als eine moderne imperiale Metropole, sondern auch als Ort der Groteske, der Komik und des Unheimlichen. Diese eigenartige Verflechtung wird anhand den Novellen „Der Mantel“, „Die Nase“, „Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen“, „Das Porträt“ und „Nevskij Prospekt“ erörtert. Im Hinblick auf kulturgeschichtlich bedeutsamen „Petersburger Text“ werden wir schließlich der Fragestellung nachgehen, wie die romantische Literatur den modernen urbanen Raum modelliert und strukturiert.
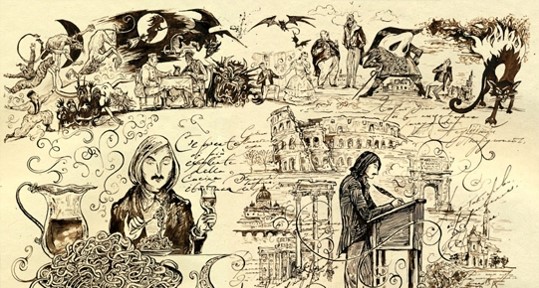
- Trainer/in: Oleksandr Zabirko
Nuclear Cultural Heritage wird gegenwärtig zu einem zunehmend relevanten Feld innerhalb der industrial heritage Forschung. Es verbindet die Ansätze der Cultural Heritage Forschung und wendet sie auf die Spezifika von Orten mit nuklearer Vergangenheit an: Wie kann an diesen Orten Kulturerbe entsteht? Ähnlich zu anderen post-industriellen Orten stehen auch hier Aspekte der Nach- und Umnutzung im Mittelpunkt, wobei der Aspekt der Kontaminierung und der verunreinigten „Altlasten“ größeres Gewicht hat. Wie kann das bauliche Erbe an diesen Orten dennoch geschützt werden und welche Rolle spielen landschaftliche Veränderungen in der Entstehung von Nuclear Cultural Heritage? Wer sind die Akteur*innen und stakeholder der Kulturerbe-Produktion und welche Praktiken des Umganges mit den materiellen Hinterlassenschaften der nuklearen Vergangenheit lassen sich beobachten? Welche Narrationen über die Vergangenheit entstehen an diesen Orten, wie materialisieren sie sich und welche Rolle spielen Prozesse der Kommodifizierung? Ferner soll danach gefragt werden, wie der „Nuclear Tourism“ die Wissensbildung und -zirkulation über die Vergangenheit verändert und welche Auswirkung der Tourismus auf die Wissensbestände der lokalen community vor Ort hat. Welche bottom-up Initiativen gibt es, die sich kritisch mit der Vergangenheit beschäftigen? Birgt die Entstehung von Nuclear Cultural Heritage subversives Potential, das Narrationen über die Vergangenheit in Frage stellt? Diese Fragen werden anhand von stillgelegten oder in Stilllegung befindlichen Orten nuklearer Produktion in Deutschland sowie im östlichen Europa besprochen.
- Trainer/in: Anna-Elena Schüler
- Trainer/in: Juliane Tomann
Viele mathematische Probleme stammen aus Anwendungsgebieten außerhalb der Mathematik und lassen sich in ihrer Komplexität nicht analytisch lösen. Numerische Verfahren und Algorithmen sind entwickelt worden, um Lösungen solcher Probleme anzunähern. Inzwischen ist für viele Industriezweige (Kommunikationstechnik, Chemie, Elektronik, Fahrzeugbau, etc.) die numerische Simulation unverzichtbar. In dieser Vorlesung sollen grundlegende numerische Verfahren und die wesentlichen Fragestellungen bei dem Entwurf, der Analyse und der Umsetzung der Algorithmen vorgestellt werden.
Folgende Themen werden behandelt:
- Rundungsfehler, Stabilität, Kondition
- Lösung linearer Gleichungssysteme mittels Elimination und Faktorisierung
- Lineare Ausgleichsprobleme
- Lösung nichtlinearer Gleichungssysteme mittels Iterationsverfahren
- Eigenwertberechnung
- Lösung linearer Gleichungssysteme mittels iterativer Verfahren
- Interpolation
- Numerische Quadratur (Berechnung von Integralen)
- Trainer/in: Helmut Abels
- Trainer/in: Saskia Lindenberg
- Trainer/in: Dennis Trautwein
Im Oberseminar Medieninformatik stellen Studierende der Medieninformatik ihre Bachelor- und Masterarbeiten vor und diskutieren mit Kommilitonen und Mitarbeitern des Lehrstuhls darüber.
- Trainer/in: Patricia Böhm
- Trainer/in: Raphael Wimmer
- Trainer/in: Christian Wolff
Im Oberseminar Medieninformatik stellen Studierende der Medieninformatik ihre Bachelor- und Masterarbeiten vor und diskutieren mit Kommilitonen und Mitarbeitern des Lehrstuhls darüber.
- Trainer/in: Raphael Wimmer
- Trainer/in: Christian Wolff
Die Logik ist die Wissenschaft vom korrekten Schlussfolgern. In der Logik werden Verfahren entwickelt und erforscht, mit denen korrekte Argumenationen konstruiert werden können und Verfahren mit denen sich bestimmen lässt, welche Argumentationen gültig sind und welche nicht. Somit ist die Logik ein wichtiges Medium der Philosophie. Die Philosophie ist eine (weitestgehend) a priori arbeitende Disziplin, d.h. in der Philosophie werden kaum empirische Studien oder Experimente herangezogen. Umso wichtiger ist es daher, Behauptungen durch möglichst gute Argumenationsketten zu stützen.
Im Basiskurs werden wir lernen, wie man sprachlich formulierte Argumente in einer exakten Formelsprache darstellen kann und sodann durch bestimmte Verfahren auf ihre Gültigkeit hin zweifelsfrei prüfen kann. Dabei beschäftigen wir uns ausschließlich mit derjenigen logischen Theorie, welche Kern und Ausgangspunkt sämtlicher weiterführenden Forschungen zur Logik ist: der elementaren Aussagen- und Prädikatenlogik.
Der Basiskurs besteht aus einem Vorlesungsteil, in dem die Konzepte und Theoriebildung der elementaren Logik eingeführt und erklärt werden soll, und einem Übungsteil, wo Studierende eigenständig Übungsaufgaben lösen und diese Lösungen in der Gruppe besprochen und verbessert werden. Der Übungsteil ist in der Logik von besonderer Wichtigkeit, da der Basiskurs vor allem auch die Fähigkeit vermitteln soll, logische Verfahren selbst anzuwenden. Diese Fähigkeit kann NUR durch selbständiges Üben erworben werden.
In Übungs- und Vorlesungsteil können je 4 ECTS erworben werden. (Nach alter Studienordnung auch: 9 ECTS für Vorlesung und Übung kombiniert). Erforderliche Leistung in der Übung: Wöchentliche Abgabe von Übungsblättern (online) Erforderliche Leistung in der Vorlesung: Abschlussklausur (Datum noch unbekannt, da Präsenzklausur erforderlich)
Der Basiskurs findet aus bekannten Gründen bis auf weiteres als reiner Onlinekurs statt. Es gibt jede Woche auf GRIPS neuen Lernstoff und es gibt Chats, wo ausführlich auf Fragen zum Stoff bzw. zu den Übungsaufgaben eingegangen wird.
Im Basiskurs kann nicht (ausführlicher) auf historische und philosophische Hintergründe zur Logik eingegangen werden. Es sei aber auf einen parallelen Essaykurs "Philosophie und Geschichte der Logik" (online GRIPS) verwiesen, in dem auf diese Hintergründe ausführlich eingegangen wird.
- Trainer/in: Holger Leuz
- Trainer/in: Ludwig Kreuzpointner
- Trainer/in: Anna Maria Mayr
Vorlesungsverzeichnis Nr.: 33 184
Zeit: Mi 8-10
Dauer: 2 Semesterwochenstunden
Turnus: wöchentlich
Beginn: 21.10.2009
Raum: ALFI 017
Der Begriff des Eisernen Vorhangs weckt seit über fünfzig Jahren Vorstellungen eines Europas, das sowohl politisch als auch kulturell geteilt war. Als Auseinandersetzung zwischen Systemen kommunistischer Diktatur und freiheitlicher Demokratie hat der Kalte Krieg lange Zeit - sowohl im öffentlichen als auch im privaten Leben - die Idee einer bipolaren Weltordnung erfolgreich verankert. Daher weckt der Kalte Krieg als historische Epoche insbesondere Erinnerungen an das nukleare Wettrüsten der Supermächte, die ideologische Spaltung in Kommunismus und Kapitalismus und den Wettstreit um die politische und kulturelle Vormachtstellung in Europa. Jedoch bilden sich seit einigen Jahren Forschungsansätze zu einer alternativen Wahrnehmung des Kalten Krieges heraus. Entgegen der klassischen Fokussierung auf Themen der Konfrontation und des Konfliktes steht hier insbesondere die Untersuchung der Transferprozesse über den Eisernen Vorhang hinweg im Zentrum der Diskussion. An diese Forschungsperspektive anknüpfend werden wir uns in diesem Proseminar mit den Möglichkeiten und Grenzen des transnationalen und transatlantischen Kulturtransfers im Kalten Krieg beschäftigen. Dabei werden wir anhand ausgewählter theoretischer Texte und exemplarischer Fallstudien die kulturgeschichtliche Dimension der Ost-West-Beziehungen im Kalten Krieg eingehend untersuchen. Weiterhin wird das Seminar Studienanfängern vielfältige Möglichkeiten bieten, sich wichtige methodische Fertigkeiten (Literaturrecherche, Entwicklung von Forschungsfragen, Bibliographieren, Schreiben von Hausarbeiten) anzueignen.
- Trainer/in: Friederike Kind-Kovács
- Trainer/in: Susanne Ehrich
- Trainer/in: Susanne Ehrich
- Trainer/in: Kathrin Pindl
- Trainer/in: Tobias Spiel
Seit Corona ist die Universität erst richtig im digitalen Zeitalter angekommen. Die Pandemie wirkt offenbar als Katalysator der Digitalisierung. Solche Thesen scheinen prima facie zutreffend. Aber stimmen sie auch? Ziel des Seminars ist es, die Geschichte der Digitalisierung und Virtualisierung der Universität aufzuarbeiten. Vor allem soll die Veranstaltung dazu dienen, auf eineinhalb Jahre universitäre Lehre unter Pandemie-Bedingungen zurückzuschauen und den Einsatz von virtuellen/digitalen Lehr- und Lernmethoden in dieser Zeit genauer unter die Lupe zu nehmen. Was hat sich bewährt, was nicht? Wie könnte die Zukunft der Universität in Post-Corona-Zeiten aussehen? Information in English Since coronavirus pandemic, the university has only effectively arrived in the digital age. The pandemic apparently acts as a catalyst for digitalisation. Such theses seem accurate at first sight. But are they also true? The aim of the seminar is to review the history of the digitalisation and virtualisation of the university. Above all, the seminar will serve to look back on one and a half years of university teaching under pandemic conditions and to take a closer look at the use of virtual/digital teaching and learning methods during this time. What has proven successful, what has not? What might the future of the university look like in post-Covid times? |
- Trainer/in: Ivo-Alexander Music
- Trainer/in: Andreas Sudmann
Dieses Seminar bietet die Möglichkeit vieler praktischer Übungen und Beobachtungen im Freien, da die historische Astronomie keine komplexe Instrumentierung erfordert. Wir werden mit der babylonischen Astronomie beginnen: Zunächst verstehen wir das metrische System und die Astronomie, die die Babylonier betrieben. Dies wird durch das Lesen und Interpretieren von Texten erarbeitet. Dann machen wir praktische Beobachtungsübungen - wir genießen die Schönheit der Abenddämmerung und diskutieren die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem mesopotamischen Himmel. Wir werden mesopotamische und griechische Sternbilder aus dem erhaltenen Text rekonstruieren und ihre Konfigurationen vergleichen, um den Transfer und die Transformation von Wissen zurückzuverfolgen. Wir werden auch die Argumente für die kugelförmige Erde lesen und nachverfolgen und selbst die Analysen durchführen, die dazu führen, a) die Größe der Erde zu messen und b) die Längengrade zweier Beobachter durch Zeitmessung zu bestimmen. Das Seminar wird eine Mischung aus Lesen, Rechnen, praktischen Beobachtungen und Erfahrungen in der Natur sein.
- Trainer/in: Kerstin Steffen-Füchsl
"Disasters breed jokes", schrieb der amerikanische Erzählforscher und Volkskundler Alan Dundes (Berkeley) im Jahr 1987 in Hinblick auf eine Welle von Witzen zur damals akuten Furcht vor AIDS. Tatsächlich liegt im Humor eine der populärsten kulturellen Strategien, Katastrophen, Ängste und Bedrohungen erzählerisch zu bewältigen. Auch am Beispiel des Challenger-Unglücks (1986), der Anschläge vom 11. September 2001 oder der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl hat die internationale Erzählforschung nachgewiesen, wie Witze gesellschaftlich entlastend wirken und dabei helfen, das Außeralltägliche zu veralltäglichen (vgl. z. B. Ellis 2001; Kuipers 2002; Morrow 1987; Schneider 2016).
Für das Erzählen im Internet nehmen in diesem Kontext MEMEs eine herausragende Rolle ein. Dies gilt auch für das aktuelle massenmediale Erzählen zur Covid-19-Krise. Reichweiten- und nutzerstarke Plattformen wie 9gag, 4chan, Reddit und andere generieren Tausende von MEMEs, die sich mit dem Thema ‚Corona’ auseinandersetzen. Bei MEMES handelt es sich um weitgehend anonyme, sich rasch verbreitende Bildergruppen, häufig mit Textkomponente, die sich tagesaktuell auf humorvolle, meist ironische Weise mit gesellschaftlich akuten Themen oder popkulturellen Phänomenen auseinandersetzen (vgl. Shifman 2014). Aufgrund ihrer Viralität und enormen Reichweite, dienen sie häufig auch als Vehikel für visuelles Storytelling in identitätspolitischen Konflikten, nicht selten auch mit rassistischen oder diskriminierenden Botschaften, und verweisen so auf größere gesellschaftspolitische und alltagskulturelle Problemlagen.
Vor diesem Hintergrund versteht dieses Seminar MEMEs im Anschluss an Hermann Bausinger als „Bilderwitze", die wir als „kulturgeschichtliche Zeugnisse“ (Bausinger 1995) nutzen können. Am Beispiel des Themas ‚Corona‘ untersuchen wir, wie das visuelle Storytelling über MEMEs im Internet funktioniert. Dabei versuchen wir, ausgehend von einer breiten, kollaborativen Materialsammlung, die Bilder und ihre Botschaften zu Covid-19 als Indikatoren für weiterreichende gesellschaftliche Konflikte zu analysieren, etwa in Hinblick auf Generationenkonflikte, Kapitalismuskritik oder rassistische und kolonialistische Untertöne. Ziel ist nicht nur eine breite Sammlung und Dokumentation von Corona-Memes, sondern vor allem auch, zu verstehen, welche dahinterliegenden alltagskulturellen Ängste, Konflikte und Bedürfnisse die Bilder angesichts der Covid-19-Pandemie artikulieren.
- Trainer/in: Manuel Trummer
- Trainer/in: Sandra Reimann
Phänomenologische Theorien stehen heutzutage in der deutschsprachigen Politikwissenschaft nicht hoch im Kurs.
Aber gleichwohl bestimmen zahlreiche Grundbegriffe der Phänomenologie das Vokabular und Denkformen der zeitgenössischen politischen Philosophie.
Das Seminar geht in kursorischer Lektüre dieser phänomenologischen Matrix nach.
Im Zentrum steht dabei die Frage nach individueller Authentizität in demokratischen Lebenswelten. Zur Sprache kommen dabei insbesondere die Theorien von Jaspers, Arendt, Marcuse, Habermas und Taylor.
Für die interkulturelle Perspektive werden die Beiträge der Autoren Gilberto Freyre, Sergio Buarque de Holanda und Jessé Souza diskutiert.
Die brasilianischen Narrative dienen vor allem der Beantwortung der Frage, inwiefern politische Theorien der Demokratie heute noch mit dem Anspruch auf Universalität vertreten werden können.
- Trainer/in: Gerson Brea
- Trainer/in: Politische Philosophie
Dieser Kurs dient dazu, alle Philosophiestudierende und -interessierte zu Veranstaltungen rund um die Philosophie in Regensburg zu informieren. Durch das Einschreiben in diesen Kurs bekommt ihr in regelmäßigen Abständen eine Mail an eure Studimailadresse, in der ihr über bevorstehende Veranstaltungen informiert werdet.
- Trainer/in: Heinrich Eiglsperger
- Trainer/in: Florian Fröhlich
- Trainer/in: Christopher Höft
- Trainer/in: Fabian Knauf
- Trainer/in: Jakob Kraemer
- Trainer/in: Tim Kraft
Untersuchungsgegenstand von Phonetik und Phonologie sind die Laute der Sprachen der Welt. Während die Phonetik sich mit den physikalischen und physiologischen Grundlagen für Produktion und Perzeption der Sprachlaute befasst, stehen in der Phonologie die systematische Verwendung von Lauten innerhalb von Einzelsprachen und im Sprachvergleich im Vordergrund. Diese Veranstaltung führt in die beiden Disziplinen ein. Wichtige Grundbegriffe und Analysemethoden werden vorgestellt und eingeübt. Folgende Themen werden unter anderen im Seminar behandelt:
Beschreibung der Laute in den Sprachen der Welt, ihrer Eigenschaften und Klassifikation (Vokale, Konsonanten; Artikulationsort und –art, usw.);
Kombinationsmöglichkeiten von Lauten zu größeren Einheiten (z.B. Silben, Wörter);
phonologische Prozesse (veränderte Aussprache eines Lautes/Wortes unter bestimmten lautlich-kontextuellen Bedingungen, Wegfall oder Hinzufügung von Lauten, usw.);
Tonsysteme und Intonation;
etc.
- Trainer/in: Johannes Helmbrecht
- Trainer/in: Veronika Landfarth
Dies hier ist ein Platzhalter für die Physik 1 für Chemiker und Lehramt mit Unterrichtsfach Physik: Mechanik. Ich finde G.R.I.P.S. eher überkompliziert; aktualisierte Informationen zu Vorlesung und Übung inklusive der Übungsblätter finden Sie auf der Homepage der Vorlesung.
Sie brauchen sich hier in G.R.I.P.S. nicht für den Kurs "einzuschreiben".
- Trainer/in: Andreas Hüttel
Schmuggler und Piraten – das klingt nach Abenteuer, dubiosen Gestalten und nächtlichen Grenzüberschreitungen, aber auch nach Sanktionen und Embargo. Das Thema, das seit Jahrzehnten in Literatur und Film in allen erdenklichen Richtungen ausgeschlachtet wird, erfreut sich jüngst auch wieder verstärkt dem geschichtswissenschaftlichen Interesse. Die Übung widmet sich diesem Themenkomplex daher aus einer historisch wissenschaftlichen Perspektive; vor dem Hintergrund des 16., 17. und 18. Jahrhunderts wird anhand von Fallbeispielen die Figur des frühneuzeitlichen Piraten untersucht, sowie die schmale Grenze zwischen Legalität und Illegalität im Überseehandel eingehend analysiert. Welche (völker-) rechtlichen Grundlagen existierten? Wie wurde die Figur des Piraten in der Öffentlichkeit wahrgenommen? In welchem Verhältnis zueinander bewegten sich Kaper und Piraterie?
An Hand ausgewählter Quellen (Texte, Bilder, Filme) werden aktuelle Forschungsansätze der Geschichte der Internationalen Beziehungen besprochen. Der atlantische Raum wird hierbei die geographische Grundlage bilden – die Bereitschaft zum lesen englisch- und deutschsprachiger Literatur wird daher bei allen Teilnehmern vorausgesetzt.
- Trainer/in: Hannes Vatthauer
Die Masterübung widmet sich den unterschiedlichen Medien, in denen sich politisch interessierte Menschen im frühneuzeitlichen Europa über im weitesten Sinne Politik informieren konnten. Anhand exemplarischer Analysen einzelner Informationsquellen (ereignisbezogene Publizistik, Lieder, Druckgraphik, periodische Medien, Lexika und Handbücher, historische und staatsrechtliche Abhandlungen, etc.) soll geklärt werden, welche Formen des politischen Wissens in diesen Medien überhaupt auf welche Weise vermittelt wurden, wer Zugriff auf sie besaß und welche Bedeutung sie für die Herausbildung einer politischen Öffentlichkeit und einer „öffentlichen Meinung“ am Ende des 18. Jahrhunderts besaßen. Zugleich führt die Übung ein in den Ansatz der Wissensgeschichte und in das Untersuchungsfeld der politischen Kommunikation.
- Trainer/in: Harriet Rudolph
- Trainer/in: Maximilian Scholler
Wie funktionierte eigentlich das Alte Reich? Welche Menschen regierten es? Auf welche politischen, rechtlichen und exekutiven Institutionen konnten sie zurückgreifen? Welche Medien nutzten Herrscher:innen, um Politik zu machen? Mit diesen und weiteren Fragen werden wir uns in dem Proseminar beschäftigen. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation (kurz: Altes Reich) entstand Ende des 15. Jahrhunderts im Zuge der Reichsreform unter Kaiser Maximilian I. und wurde 1806 mit der Niederlegung der Krone durch Franz II. offiziell für beendet erklärt. Es war kein Staat mit vom Volk gewählten Vertreter:innen in einem modernen Sinn, sondern ein ständisch geprägtes Gefüge mit einer monarchischen Führung und institutionellen Strukturen. Schon von der zeitgenössischen Reichspublizistik wurde das Reich aufgrund seiner komplexen Strukturen und Machtverteilung zwischen Kaiser, Reichständen und weiteren Reichsgliedern als ‚irregulär, einem Monstrum ähnlich‘ (Pufendorf) bezeichnet. Seit Beginn der Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert wurde es ganz unterschiedlich bewertet. Aus Sicht der nationalstaatlich geprägten Historiographie erschien es als „nationales Unglück“ (Treitschke), das die Bildung moderner Staatlichkeit verhindert habe. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand eine Neubewertung statt und man betrachtete das Alte Reich als ein supranationales, föderatives System, das der Friedenswahrung diente. Aus einer kulturhistorischen Perspektive rückte seit den 1990er Jahren zunehmend das Rituelle und Symbolhafte der politischen Kultur in den Blick.
In dem Proseminar widmen wir uns in drei Blöcken den zentralen Akteuren, Institutionen und Medien der politischen Kultur im Heiligen Römischen Reich. Dazu gehören natürlich Kaiser, Kurfürsten und weitere Reichsglieder, die Gerichte des Alten Reichs sowie die Exekutivgewalten, aber auch die kommunikativen Strukturen wie Flugblätter, Druckwerke und briefliche Korrespondenzen.
Literatur
Gotthard, Axel, Das Alte Reich 1495–1806, Darmstadt 2003.
Schmid, Georg, Geschichte des Alten Reiches. Staat und Nation in der Frühen Neuzeit 1495–1806, München 1999.
Schnettger, Matthias, Kaiser und Reich. Eine Verfassungsgeschichte (1500–1806), Stuttgart 2020.
Stollberg-Rilinger, Barbara, Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Vom Ende des Mittelalters bis 1806. 5., aktualisierte Auflage, München 2013.
Whaley, Joachim, Das Heilige Römische Reich deutscher Nation und seine Territorien. 2 Bde., Darmstadt 2014.
- Trainer/in: Anne Mariss
Welche Rolle spielen Tiere und Maschinen, Blitze und Schleim, Atome und Elektronen in einer posthumanistischen Weltsicht? Wie lässt die Welt sich verstehen, wenn der Mensch nicht länger das Maß aller Dinge ist? Wie kommen wir zu gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen, wenn wir selbst, als Menschen, nicht länger als stilles und nicht hinterfragbares Fundament wissenschaftlicher Praktiken gesetzt werden können?
Ausgehend von solchen Fragen beschäftigen wir uns in diesem Seminar mit Theorien und Perspektiven in Bezug auf posthumanistische Objektivität. Beginnend mit Standpunktheorien und situierten Wissen, stellen wir ökofeministischen Ansätzen das Konzept der:des Cyborg:s gegenüber und erkunden den agentiellen Realismus Karen Barads. Wir diskutieren, was wir unter Posthumanismus verstehen können, welchen Problemstellungen und Zielen sich die genannten Ansätze verbunden bzw. verpflichtet sehen, welche Epistemologien und Konzepte von Objektivität hier verhandelt werden und welche politischen Überlegungen damit einhergehen. Wir legen besonderen Fokus auf die medientechnischen Bezüge in diesen Ansätzen und fragen uns, was es bedeuten kann, eine brauchbare, ethisch verantwortliche Form von Objektivität zu entwickeln, die naturwissenschaftlichen Standards verpflichtet bleibt und den Einfluss von technischen Medien auf wissenschaftliche Praktiken mit beachtet.
Sie erhalten in diesem Seminar eine breitgefächerte Einführung in die Bedeutung von Objektivität im Rahmen des Posthumanismus und der kritischen Auseinandersetzung mit Wissenschaft. Dabei werden Kompetenzen in Leseverständnis und Diskussionsfähigkeit vertiefend eingeübt.
- Trainer/in: Thomas Nyckel
Inhaltliche Zusammenfassung:
Typologien der Regierungssysteme werden erörtert, um die oft besonders starke Stellung der Präsidenten in den parlamentarischen Regierungssystemen Mittel- und Osteuropas zu verdeutlichen. An Beispielen von ausgewählten Ländern wird gefragt, woher die politische Stärke bzw. Schwäche der Staatsoberhäupter in den Systemen der dualen Exekutive herrühren kann: von der Person des Amtsinhabers, vom Institutionalisierungsgrad der Parteien und Parteiensysteme, von der politischen Kultur u.a. Der Erwerb des Oberseminarscheins ist möglich.
- Trainer/in: Theresa Merz
- Trainer/in: Nadia Wittmann
Voranmeldung für das Praktikum Chemie für Studierende der Physik (PHY-B-WE 1.3)
Das Praktikum findet statt im SoSe 2024 vom 02. September bis zum Y. September. Durch Ihren Beitritt zu diesem Praktikumskurs sind Sie nur vorangemeldet. Erst durch Ihre Teilnahme an der Sicherheitsunterweisung, dessen Termin beim Eintritt bekannt gegeben wird, werden Sie offiziell angemeldet. Das Praktikum ist auf eine Teilnehmeranzahl von max. 32 begrenzt, und daher wird eine Prioritätenliste aller angemeldeten Studenten gemäß Ihres Anmeldungszeitpunktes erstellt. Sollten vorangemeldete Studenten nicht an der Sicherheitsunterweisung teilnehmen, werden diese aus der Liste gestrichen und die nachfolgenden Studenten rücken in der Liste auf. Sollten mehr als 32 Studenten sich vorangemeldet haben und auch an der Sicherheitsunterweisung teilgenommen haben, wird ein zweiter Praktikumstermin zum WiSe 2024/25 voraussichtlich vom X.02.2023 bis zum Y.03.2023 angeboten, so dass alle Studenten an diesem Praktikum teilnehmen können.
Qualifikationsziele des Chemisches Praktikum für Physiker (PHY-B-WE 1.3) / zu erwerbende Kompetenzen:
(Bevor der Teilnamhe am chemischen Praktikum für Physiker sollten vorab die beiden Vorlesungen Chemie für Physiker I & II (PHY-B-WE 1.1 & 1.2) absolviert worden sein.)
Die erfolgreiche Teilnahme an diesem Modul gibt ihnen die Fähigkeit, elementare Eigenschaften verschiedener Stoffklassen aus ihrer atomar-chemischen Struktur heraus zu erklären und ihre wichtigsten Reaktionen zu verstehen.
Sie erwerben die Fähigkeit, sich im Hinblick auf eine spätere wissenschaftliche Labortätigkeit
a) ggf. selbständig Details über spezielle Alterungsprozesse von Proben aneignen zu können, sowie
b) das notwendige grundlegende Bewusstsein insbesondere für toxische und explosive Gefahren anzueignen, um abschätzen zu können, wo Expertenrat sinnvoll ist.
Inhalt des Praktikums
Folgende 10 Versuche werden durchgeführt:
1. Gemisch und Verbindungen, Säuren und Basen
2. Chemie der Halogene, Spannungsreihe
3. Iodometrie, weitere Redoxreaktionen
4. Kristallzüchtung, Löslichkeitsprodukt und Massenwirkungsgesetz, Reinigung durch Ausfällen und Umkristallisieren
5. Massenwirkungsgesetz, Hydroxide und Sulfide
6. Qualitative Analyse
7. Gravimetrie und Fällungstitration
8. Verteilung, Chromatographie, Elektrogravimetrie
9. Kohlenstoffverbindungen, Destillation, Infrarotspektroskopie
10. Kinetik der alkalischen Esterhydrolyse
- Trainer/in: Roger Kutta
Dies ist ein Online-Kurs ohne synchrone Termine. Informationen werden über GRIPS kommuniziert.
Ziel des Praktikumsseminars ist es, dass zum einen Sie selbst Ihr absolviertes Praktikum im Kontext Ihres medienwissenschaftlichen Studiums reflektieren; zum anderen, dass Sie über die Erfahrungen Ihrer KommilitonInnen Einblicke in Berufsfelder erhalten.
Detaillierte Informationen werden im Kurs beim Kurs-Start bereitgestellt werden.
Wenn Sie einen Platz im Kurs zugeteilt bekamen, werden Sie zum Kurs hinzugefügt werden – eine Selbsteinschreibung wird nicht möglich sein, es wird keinen Einschreibeschlüssel geben/benötigt. Die Einschreibung erfolgt in der ersten Semesterwoche (ab 12.04.21).
- Trainer/in: Solveig Ottmann
Dies ist ein Online-Remote-Kurs ohne synchrone Termine. Informationen werden über GRIPS kommuniziert.
Ziel des Praktikumsseminars ist es, dass zum einen Sie selbst Ihr absolviertes Praktikum im Kontext Ihres medienwissenschaftlichen Studiums reflektieren; zum anderen, dass Sie über die Erfahrungen Ihrer KommilitonInnen Einblicke in Berufsfelder erhalten.
Detaillierte Informationen werden im Kurs beim Kurs-Start bereitgestellt werden.
Wenn Sie einen Platz im Kurs zugeteilt bekamen, werden Sie nach der letzten Platzvergabe den Zugangsschlüssel per E-Mail erhalten. Die Einschreibung erfolgt in der ersten Vorlesungswoche (ab 25.04.22).
- Trainer/in: Solveig Ottmann
Dies ist ein Online-Kurs ohne synchrone Termine. Informationen werden über GRIPS kommuniziert.
Ziel des Praktikumsseminars ist es, dass zum einen Sie selbst Ihr absolviertes Praktikum im Kontext Ihres medienwissenschaftlichen Studiums reflektieren; zum anderen, dass Sie über die Erfahrungen Ihrer KommilitonInnen Einblicke in Berufsfelder erhalten.
Detaillierte Informationen werden im Kurs beim Kurs-Start bereitgestellt werden.
Wenn Sie einen Platz im Kurs zugeteilt bekamen, werden Sie zum Kurs hinzugefügt werden – eine Selbsteinschreibung wird nicht möglich sein, es wird keinen Einschreibeschlüssel geben/benötigt. Die Einschreibung erfolgt in der ersten Semesterwoche (ab 02.11.20).
Bitte beachten Sie im Folgenden ferner die inhaltliche Kursbeschreibung: https://lsf.uni-regensburg.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung&veranstaltung.veranstid=157509.
- Trainer/in: Solveig Ottmann
Dies ist ein Online-Remote-Kurs ohne synchrone Termine. Informationen werden über GRIPS kommuniziert.
Ziel des Praktikumsseminars ist es, dass zum einen Sie selbst Ihr absolviertes Praktikum im Kontext Ihres medienwissenschaftlichen Studiums reflektieren; zum anderen, dass Sie über die Erfahrungen Ihrer KommilitonInnen Einblicke in Berufsfelder erhalten.
Detaillierte Informationen werden im Kurs beim Kurs-Start bereitgestellt werden.
Wenn Sie einen Platz im Kurs zugeteilt bekamen, werden Sie nach der letzten Platzvergabe den Zugangsschlüssel per E-Mail erhalten. Die Einschreibung erfolgt in der ersten Vorlesungswoche (ab 18.10.21).
- Trainer/in: Solveig Ottmann
Dies ist ein Online-Kurs ohne synchrone Termine. Informationen werden über GRIPS kommuniziert.
Ziel des Praktikumsseminars ist es, dass zum einen Sie selbst Ihr absolviertes Praktikum im Kontext Ihres medienwissenschaftlichen Studiums reflektieren; zum anderen, dass Sie über die Erfahrungen Ihrer KommilitonInnen Einblicke in Berufsfelder erhalten.
Detaillierte Informationen werden im Kurs beim Kurs-Start bereitgestellt werden.
Wenn Sie einen Platz im Kurs zugeteilt bekamen, werden Sie zum Kurs hinzugefügt werden – eine Selbsteinschreibung wird nicht möglich sein, es wird keinen Einschreibeschlüssel geben/benötigt. Die Einschreibung erfolgt in der ersten Semesterwoche (ab 12.04.20).
- Trainer/in: Solveig Ottmann
Dies ist ein Online-Remote-Kurs ohne synchrone Termine. Informationen werden über GRIPS kommuniziert.
Ziel des Praktikumsseminars ist es, dass zum einen Sie selbst Ihr absolviertes Praktikum im Kontext Ihres medienwissenschaftlichen Studiums reflektieren; zum anderen, dass Sie über die Erfahrungen Ihrer KommilitonInnen Einblicke in Berufsfelder erhalten.
Detaillierte Informationen werden im Kurs beim Kurs-Start bereitgestellt werden.
Wenn Sie einen Platz im Kurs zugeteilt bekamen, werden Sie nach der letzten Platzvergabe den Zugangsschlüssel per E-Mail erhalten. Die Einschreibung erfolgt in der ersten Vorlesungswoche (ab 25.04.22).
- Trainer/in: Solveig Ottmann
Dies ist ein Online-Kurs ohne synchrone Termine. Informationen werden über GRIPS kommuniziert.
Ziel des Praktikumsseminars ist es, dass zum einen Sie selbst Ihr absolviertes Praktikum im Kontext Ihres medienwissenschaftlichen Studiums reflektieren; zum anderen, dass Sie über die Erfahrungen Ihrer KommilitonInnen Einblicke in Berufsfelder erhalten.
Detaillierte Informationen werden im Kurs beim Kurs-Start bereitgestellt werden.
Wenn Sie einen Platz im Kurs zugeteilt bekamen, werden Sie zum Kurs hinzugefügt werden – eine Selbsteinschreibung wird nicht möglich sein, es wird keinen Einschreibeschlüssel geben/benötigt. Die Einschreibung erfolgt in der ersten Semesterwoche (ab 02.11.20).
Bitte beachten Sie im Folgenden ferner die inhaltliche Kursbeschreibung: https://lsf.uni-regensburg.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung&veranstaltung.veranstid=157509.
(Detaillierte Informationen werden im Kurs beim Kurs-Start bereitgestellt).
- Trainer/in: Solveig Ottmann
Dies ist ein Online-Remote-Kurs ohne synchrone Termine. Informationen werden über GRIPS kommuniziert.
Ziel des Praktikumsseminars ist es, dass zum einen Sie selbst Ihr absolviertes Praktikum im Kontext Ihres medienwissenschaftlichen Studiums reflektieren; zum anderen, dass Sie über die Erfahrungen Ihrer KommilitonInnen Einblicke in Berufsfelder erhalten.
Detaillierte Informationen werden im Kurs beim Kurs-Start bereitgestellt werden.
Wenn Sie einen Platz im Kurs zugeteilt bekamen, werden Sie nach der letzten Platzvergabe den Zugangsschlüssel per E-Mail erhalten. Die Einschreibung erfolgt in der ersten Vorlesungswoche (ab 18.10.21).
- Trainer/in: Solveig Ottmann