- Trainer/in: Magdalena Daller
GRIPS - Uni Regensburg
Suchergebnisse: 1760
- Trainer/in: Magdalena Golonka
- Trainer/in: Friederike Pronold-Günthner
Geschichtsstudierenden der Uni Regensburg bietet die Stadt Regensburg ein Ensemble an an Kirchen und Klöstern, die gerade für die mittelalterliche Epoche sehr prominent sind. Die Reichsabtei St. Emmeram war im 10./11. Jahrhundert eine der reichsten und mächtigsten Klöster im Reich; die adligen Damenstifte Nieder-, Ober- und Mittelmünster genossen im frühen Mittelalter größtes Ansehen über die Stadtgrenzen hinaus. Im 13. Jahrhundert verdichtete sich die Sakraltopographie durch die Ankunft der Bettelorden in Regensburg. Dominikaner und Minoriten haben zwei der am besten erhaltenen deutschen Klosterkirchen des 13. Jahrhunderts hinterlassen. Darüber hinaus gibt es auch ein seit dem Mittelalter bestehendes und heute noch aktives Kloster (Heiligkreuz, Dominikanerinnen) und zahlreiche kleinere Klöster, die sich im Stadtraum „verstecken“ (z.B. Deutschordenskommende St. Leonhard). Diese Übung richtet sich vor allem an jüngere Semester, die wissen möchten, in welcher Stadt sie studieren, wie man mit offenen Augen die historischen Zeugnisse ihres Studienortes zum Verständnis des Mittelalters begreifen lernen und dadurch sein Studium dieser Epochen wesentlich bereichern kann. Es werden in der Blockübung ausgewählte Schriftzeugnisse des Mittelalters zusammen erarbeitet und durch Exkursionen im Regensburger Stadtraum ergänzt.
- Trainer/in: Sonja Neumeier
- Trainer/in: Jörg Oberste
- Trainer/in: Frieda Walter
Geschichtsstudierenden der Uni Regensburg bietet die Stadt Regensburg ein
Ensemble an an Kirchen und Klöstern, die gerade für die
mittelalterliche Epoche sehr prominent sind. Die Reichsabtei St. Emmeram
war im 10./11. Jahrhundert eine der reichsten und mächtigsten Klöster
im Reich; die adligen Damenstifte Nieder-, Ober- und Mittelmünster
genossen im frühen Mittelalter größtes Ansehen über die Stadtgrenzen
hinaus. Im 13. Jahrhundert verdichtete sich die Sakraltopographie durch
die Ankunft der Bettelorden in Regensburg. Dominikaner und Minoriten
haben zwei der am besten erhaltenen deutschen Klosterkirchen des 13.
Jahrhunderts hinterlassen. Darüber hinaus gibt es auch ein seit dem
Mittelalter bestehendes und heute noch aktives Kloster (Heiligkreuz,
Dominikanerinnen) und zahlreiche kleinere Klöster, die sich im Stadtraum
„verstecken“ (z.B. Deutschordenskommende St. Leonhard). Diese Übung
richtet sich vor allem an jüngere Semester, die wissen möchten, in
welcher Stadt sie studieren, wie man mit offenen Augen die historischen
Zeugnisse ihres Studienortes zum Verständnis des Mittelalters begreifen
lernen und dadurch sein Studium dieser Epochen wesentlich bereichern
kann. Es werden in der Blockübung ausgewählte Schriftzeugnisse des
Mittelalters zusammen erarbeitet und durch Exkursionen im Regensburger
Stadtraum ergänzt.
- Trainer/in: Ljubov Avila
- Trainer/in: Philipp Bucksteeg
- Trainer/in: Sonja Neumeier
- Trainer/in: Jörg Oberste
Das Blockseminar richtet sich an fortgeschrittene Masterstudierende und
Doktorand:innen und nähert sich dem Schreiben für die Wissenschaft in
drei Schritten: In einem ersten Teil soll es um die eigenen
Schreibkompetenzen beim Verfassen wissenschaftlicher Texte und um gutes
Wissenschaftsdeutsch gehen. Welcher Schreibtyp bin ich, wie strukturiere
ich den Schreibprozess eines umfassenderen wissenschaftlichen Textes
und wie schreibe ich verständlich? Zweitens wird in die Praxis der
Textredaktion und den Prozess der Veröffentlichung wissenschaftlicher
Texte eingeführt. Im dritten Teil des Seminars steht die gute
wissenschaftliche Praxis (GWP) im Zentrum. In Orientierung am 2019
veröffentlichten Leitfaden der DFG soll für die Problematik
wissenschaftlichen Fehlverhaltens sensibilisiert und der verantwortete
Umgang mit Daten und Quellen reflektiert werden.
- Trainer/in: Susanne Ehrich
- Trainer/in: Tobias Spiel
Nicht erst seit dem Aufkommen des Feminismus oder dessen 2. oder 3. Welle experimentieren Frauen mit dem Medium Photographie und produzieren Kunst. Lange waren sie und ihre Werke jedoch unsichtbar bzw. wurden nicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen und diskutiert. Im Seminar wollen wir im späten 19. Jahrhundert ansetzen und auf frühe sowie spätere Photographinnen blicken (Jessie Tarbox Beals, Florestine Perrault Collins, Tina Modotti, Candida Höfer, Hilla Becher, Hannah Reyes Morales etc.) und ihre Arbeiten einer Bildanalyse im sozialpolitischen sowie medienhistorischen Kontext unterziehen.
- Trainer/in: Silke Rösler-Keilholz
- Trainer/in: Lioba Scharrenbroich
Dieser Kurs wendet sich an Studierende, die Russisch und/oder BKS mindestens auf Niveau B1 beherrschen. Wir versuchen, unsere Studieninhalte aus den (süd-) osteuropabezogenen Area Studies in Sprachen der Region zu diskutieren, anhand von Schlüsseltexten (Reden, Interviews, Zeitungsartikeln) in den Originalsprachen, die wir dann ebenso in den Originalsprachen diskutieren. Anders als die Spracherwerbskurse zielt dieser Kurs darauf, diejenigen Fachinhalte, die aus den Fächern Geschichte und Gesellschaftswissenschaften in der Regel in Deutsch oder Englisch besprochen zu werden, auch in wichtigen Zielsprachen der Region formulieren zu können. Die Sitzungen werden abwechselnd auf Russisch und BKS abgehalten. Diejenigen, deren erlernte Sprache in einer Sitzung gerade nicht an der Reihe ist, trainieren bei dieser Gelegenheit ihr Hörverstehen der „unbekannten“ Sprache und lösen dazu Quizaufgaben. Das Qualifizierungsziel der Übung ist, die Übertragung fachwissenschaftlichen Wissens in eine Kommunikation in der Zielsprache zu erleichtern und damit den Einsatz jenseits des westlichen akademischen Kontexts zu ermöglichen, etwa bei Auslandsaufenthalten im postjugoslawischen und postsowjetischen Raum oder im Kontakt mit Menschen aus diesen Räumen, die bei uns leben und mit denen eine Kommunikation auf Deutsch (noch) nicht möglich ist.
Anforderungen: Regelmäßige Teilnahme; Lektüre; Teilnahme an Diskussion; Vor- und Nacharbeiten von Wortfeldern, Ausdrucksweisen, die für den aktiven Sprachgebrauch notwendig sind
- Trainer/in: Klaus Buchenau
- Trainer/in: Edith Feistner
- Trainer/in: Kim Wüstenhagen
Die ist ein Online-Kurs. Materialien und sonstige Informationen werden über GRIPS oder email kommuniziert. Neben der Lektüre von Texten ist wöchentlich eine schriftliche Analyse einer Photographie virtuell einzureichen. Zu simultan stattfindenen Zoom-Sitzungen wird es nur in Ausnahmefällen kommen.
- Trainer/in: Franziska Findeis
- Trainer/in: Silke Rösler-Keilholz
Dies ist ein Online-Kurs. Materialien und sonstige Informationen werden über GRIPS oder email kommuniziert. Neben der Lektüre von Texten ist wöchentlich eine schriftliche Analyse einer Photographie virtuell einzureichen. Zu simultan stattfindenen Zoom-Sitzungen wird es nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Ankündigung kommen - vermutlich dann zur Seminarzeit dienstags um 14 Uhr.
- Trainer/in: Franziska Findeis
- Trainer/in: Silke Rösler-Keilholz
Dies ist ein asynchroner Online-Kurs. Aufgaben und Informationen werden
über GRIPS und/oder email kommuniziert. Wöchentlich müssen bis zum
Ende der Vorlesungszeit schriftliche Hausaufgaben angefertigt und auf
GRIPS eingestellt werden. Zoom-Sitzungen finden nur sporadisch statt -
die Teilnahme an diesen Terminen ist nicht verpflichtend.
- Trainer/in: Franziska Findeis
- Trainer/in: Silke Rösler-Keilholz
- Trainer/in: Edith Feistner
- Trainer/in: Christina Hafner
- Trainer/in: Nicole Wagner
- Trainer/in: Regine Weber
Den Regionalwissenschaften (area studies) geht mitunter der Ruf voraus, eher locker in disziplinäre Diskussionen und enger in politische Netzwerke eingebunden zu sein. Die Kritik bezieht sich auf die gesamte Geschichte der Area Studies seit dem 19. Jahrhundert: Zum Beispiel auf ihre Nähe zu britischen und französischen Kolonialbehörden, deren Herrschaft Regionalspezialisten aus Anthropologie oder Orientalistik angeblich erleichterten; auf die Instrumentalisierung der (Süd)Osteuropakunde durch Nationalsozialisten, Kalte Krieger und schließlich auf heutige Denkfabriken verschiedener Couleur, die auf Osteuropa-Expertise zurückgreifen, um postsozialistische Gesellschaften in ihrem Sinne zu transformieren.
Die Vorwürfe übermäßiger Politiknähe konnten, trotz der Aufarbeitung der „orientalistischen“ und nationalsozialistischen Verstrickungen, auch deshalb nicht ad acta gelegt werden, weil seit 1989 immer neue Krisen eine Zusammenarbeit von Area Studies und Politik begünstigen, sei es bei den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien und in der Ukraine, bei der Migrations- und Fluchtproblematik oder dem Phänomen des sogenannten Rechtspopulismus. Durch Themen wie Corona und Klima ist zudem ein verstärkter Szientizismus in die Politik eingezogen, d.h. Politik wird heute mehr als früher mit „der“ Wissenschaft begründet, die angeblich dieses oder jenes zwingend verlange. Dadurch erhalten Forschende zwar öffentliche Aufmerksamkeit, laufen gleichzeitig aber auch Gefahr ihre Freiheit einzubüßen, weil die Politik von ihnen eindeutige Botschaften verlangt. Die moderne, auf Produktivität getrimmte Universität ist ebenfalls Teil dieses Problemkomplexes, denn sie erwartet öffentliche Präsenz und eine „dritte Mission“ über den Tellerrand der Wissenschaft hinaus als Bringschuld gegenüber der Gesellschaft.
In der Übung setzen wir uns tiefer mit diesen Prozessen auseinander und überlegen in einer Art Zukunftswerkstatt, welche Art von Area studies und welche Beziehung zur Politik eigentlich wünschenswert sind.
Leistungsnachweis: Regelmäßige Teilnahme, Lektüre, Referat.
Einführende Literatur: Katrin Boeckh, Hermann Beyer-Thoma: Osteuropa in Regensburg. Institutionen der Osteuropa-Forschung aus ihrer historischen Perspektive. Regensburg 2008.
- Trainer/in: Klaus Buchenau
Athanasius Kircher (1602-1680), Jesuit, Forscher, Reisender, Erfinder und Schriftsteller in einer Person, liefert für die Musik- und Akustikforschung zentrale Ansätze einer Affektenlehre, er versieht seine Schriften mit Kompositionen wie einer Tarantella, in seinen Gedankenexperimenten erfindet er Musikinstrumente, Abhör- und Beschallungsanlagen und verbindet diese, ganz Universalgelehrter, mit Wissenschaften wie der Mathematik, Geographie, Astronomie und der Medizin.
Anhand der Lektüre der aktuellen Übersetzung von Kirchers Musurgia universalis (Rom 1650) und der Neuen Hall- und Thonkunst von 1684 wollen wir uns der Ideenwelt des 17. Jahrhunderts nähern. Sollte in der zweiten Semesterhälfte Präsenzunterricht möglich sein, werden wir uns in einer Exkursion ausgewählte Instrumente anschauen.
- Trainer/in: Rebecca Wolf
Viel mehr Migration geht eigentlich nicht: Seit dem beginnenden 14. Jahrhundert im heutigen oberbayerisch-oberpfälzisch-fränkischen Grenzgebiet erwähnt, ist das Geschlecht der Khevenhüller Ende desselben Jahrhunderts als bamberigsche Pfleger in Villach nachweisbar, wo es im 16. Jahrhundert zu einem der wichtigsten Geschlechter in Kärnten aufstieg. Die prunkvollen Gräber in der Villacher Stadtkirche zeugen noch heute hiervon. Früh zum Protestantismus konvertiert, machten Mitglieder der Familie dessen ungeachtet im kaiserlichen Dienst Karriere, bauten ihre Stellung in Kärnten aus und erreichten Ende des 16. Jahrhunderts die Erhebung in den Grafenstand. Als Kaiser Ferdinand II. die habsburgische Konfessionspolitik indes wieder verschärfte, war der protestantisch bleibende Zweig der Familie zur Emigration gezwungen. Während rekonvertierte Familienmitglieder unverändert im kaiserlichen Windschatten Karriere machten, ließ sich der evangelische Zweig im Nürnberger Umfeld nieder.
Die Übung wird an ausgewählten Texten und Quellen der Familiengeschichte als exemplarischem Beispiel des Exulantentums nachgehen. Dabei sollen theoretischen Fragen nach der Ausformung der Konfessionalisierung genauso zur Sprache kommen wie solche, die die moderne Migrationsforschung stellt.
- Trainer/in: Michaela Stauber
- Trainer/in: Jörg Zedler
- Trainer/in: Susanne Ehrich
- Trainer/in: Rita Geiger
In den 2020ern prägen erinnerungskulturelle Debatten um das „postkoloniale“ Erbe die öffentlichen Debatten, sowohl in den Gesellschaften der ehemaligen Kolonialmächte als auch der ehemaligen Kolonisierten. Beispiele hierfür sind Forderungen nach der Restitution von Kunstschätzen kolonialer Provenienz (wie die Benin-Bronzen), Kontroversen über Denkmäler (wie die 2015 gestürzte Statue von Cecil Rhodes vor der Universität Kapstadt) und Straßennamen (wie die M*-Straße in Berlin) oder Debatten über Reparationen (z.B. für den transatlantischen Versklavungshandel oder den Genozid an den Ovaherero und Nama).
In dieser Übung sollen die komplexen wissenschaftlichen, juristischen, politischen und ethischen Fragen, die sich im Rahmen erinnerungskultureller Kontroversen über das postkoloniale Erbe stellen, aus transnationaler Perspektive untersucht werden. Dabei kann es um den Gegenstand gehen, die beteiligten Akteur:innen, die Rezeptionsebene oder die gestellten Forderungen.
- Trainer/in: Philipp Bernhard
- Trainer/in: Jana Vinga Martins
- Trainer/in: Susanne Ehrich
- Trainer/in: Rita Geiger
- Trainer/in: Johannes Molz
Die Vorlesung ist Teil des viersemestrigen Zyklus von Überblicksvorlesungen („Basismodul Musikgeschichte”). Aus dem 17. Jh. sollen mit Claudio Monteverdi (1567–1643), Heinrich Schütz (1585–1672) und Jean-Baptiste Lully (1632–1687) die bedeutendsten Komponisten Italiens, Deutschlands und Frankreichs betrachtet werden. Um 1680 wird mit den Werken Arcangelo
Corellis (1653–1713) ein instrumental geprägter Ton europaweit dominant, ein Prozess, der im Werk von Johann Sebastian Bach (1685–1750) gipfelt. Andere Wurzeln hat die Sinfonik der Mannheimer Schule und Joseph Haydns, und die repräsentative öffentliche Musikform der Oper in französischer sowie insbesondere in italienischer Gestalt verbindet – gleichsam an Bach vorbei – den Anfang des 18. Jahrhunderts mit dessen Ende: Wolfgang Amadeus Mozarts Musik ist ohne Italien nicht denkbar.
- Trainer/in: Katelijne Schiltz
Unter „Musikgeschichte der Renaissance“ fasst man üblicherweise die Musik der Zeit zwischen ca. 1430 und 1600, also grob: zwischen Dufay und Monteverdi. Das Ausziehen grober Linien und die Stoffvermittlung stehen im Mittelpunkt dieses Vorlesungstyps, doch wollen wir uns gleichzeitig auf einzelne Themenbereiche konzentrieren. Einige Schwerpunkte werden sein: – „Europa“ im 15. und 16. Jh.; – „Humanismus“ im Musikschrifttum; – „Kirchliche“, „geistliche“ und „weltliche” Musik; – Uniformierungstendenzen in der Komposition des 16. Jahrhunderts; – Techniken und Bedeutung des Musikdrucks usw.
- Trainer/in: Katelijne Schiltz
Die Digitalisierung durchdringt heute alle Lebensbereiche, durch Smartphones und Tablets sind Informationen jederzeit und überall abrufbar. Die unbestreitbaren Chancen und Möglichkeiten dieser ‚digitalen Revolution‘ stellen gleichzeitig die schulische Lehre und damit die Ausbildung von Lehrkräften vor neue Herausforderungen.
Im Zentrum der Übung stehen zunächst fachdidaktische Methoden und Theorien zu außerschulischen Lernorten sowie zu digitalen Lehr-Lernmedien, die dann in einem praktischen Teil am Beispiel der App Future History erprobt werden sollen. Die Grundlagen hierfür werden in einem ersten, wöchentlich stattfindenden Teil gelegt. Ziel des zweiten, als Blockveranstaltung stattfindenden Teils ist es, das Erlernte in die Praxis zu überführen und eine digitale historische Stadtführung durch Regensburg zu konzipieren. Dabei sollen dann auch fachwissenschaftliche Aspekte zur mittelalterlichen Stadtgeschichte mit fachdidaktischen Überlegungen kombiniert werden.
- Trainer/in: Johanna Buhl
- Trainer/in: Julian Zimmermann
Die Übung führt in Methoden transkultureller Geschichtsforschung ein und
diskutiert die Möglichkeiten (und Grenzen) ihrer Anwendbarkeit anhand
ausgewählter Beispiele aus der früh- und hochmittelalterlichen
Geschichte.
Ziel der Veranstaltung ist, dass die Teilnehmer sowohl verschiedene
Methoden (Shared History, Verflechtungsgeschichte, entangled histories,
Komparatistik) im Zusammenhang ihrer jeweiligen Entstehungskontexte
kennenlernen sowie gemeinsam im Seminar erproben, inwieweit diese
Ansätze für die Analyse ausgewählter Quellen bzw. zur Beschreibung
bestimmter historischer Entwicklungen nutzbar gemacht werden können.
- Trainer/in: Jenny Oesterle
- Trainer/in: Tobias Spiel
Rezensionen sind eine kleine Textsorte, mit der man nicht berühmt wird. Aber sie sind alles andere als unwichtig. Denn wir sind auf Hilfestellungen angewiesen, die uns Orientierung in zunehmend unübersichtlichen Wissensfeldern ermöglichen. Rezensionen gehören hier zu den wichtigen Dienstleistungen, sind aber mehr als das. Sie dienen auch als Medium intellektueller Verständigung, das sehr verschiedene Färbungen annehmen kann. Der Ton einer Rezension kann zum Beispiel vorsichtig-nacherzählenden sein, polemisch-entlarvend oder interpretierend-kreativ. Nicht zuletzt tragen Rezensionen zu intellektuellen Debatten bei, sie sind unverzichtbar für den Dialog von Geisteswissenschaften und breiterer Öffentlichkeit. Weil Rezensionen eine kurze Gattung mit einer sehr klaren Materialgrundlage sind, eignen sie sich für eine Übung. In dieser Veranstaltung wird geübt, wie man große Linien eines Buches prägnant wiedergibt, ein Werk in einen Kontext einordnet; wie man einen Autor kritisiert, ohne zu verletzen; und nicht zuletzt, wie man zu einem gut lesbaren Text kommt. Die Teilnehmer können nach eigenem Interesse ihren Rezensionstitel aus aktuellen Neuerscheinungen zu Südosteuropa (in zweiter Linie auch zu Osteuropa) auswählen. Jede Rezension wird mehrfach in der Veranstaltung besprochen und zur Überarbeitung zurückgegeben. Gut gelungene Texte können, bei entsprechendem Bedarf der einschlägigen Rezensionsforen, auch veröffentlicht werden.
- Trainer/in: Klaus Buchenau
Vom 13.-16 Mai 2016 findet das Festival Tage Alter Musik statt. Es sind Konzerte mit Musik vom 14. bis zum 18. Jahrhundert geplant. Im Rahmen der Übung werden wir uns mit einer Auswahl der Kompositionen, die auf dem Programm stehen, den Komponisten und den aufführenden Ensembles
beschäftigen. Auf dieser Grundlage werden wir Texte für das Programmheft der Tage Alter Musik verfassen. Die Teilnehmer haben darüber hinaus die Möglichkeit, während des Festivals aktiv mitzuarbeiten und so wichtige praktische Erfahrungen zu sammeln.
- Trainer/in: Katelijne Schiltz
Die Veranstaltung orientiert sich am Kanon für die Staatexamensprüfung nach der neuen LPO I, der ab dem Prüfungstermin Herbst 2023 zum Einsatz kommt.
Vorausgesetzt wird der Stoff der Vorlesung zur spanischen und lateinamerikanischen Literaturgeschichte, die zuletzt im Wintersemester 2023/24 stattgefunden hat.- Trainer/in: Dagmar Schmelzer
- Trainer/in: Anna Höcherl
Zeit: Dienstag, 12-14 Uhr
Raum: PT 2.0.9
Modul: SOE M 02
Leistungsanforderungen:
- Regelmäßige und aktive Teilnahme
- Regelmäßige Literaturlektüre
- aktive Teilnahme an der Gruppenarbeit
Benotete Leistungen:
- Textpräsentation, Abgabe Exzerpt
- Trainer/in: Karolina Novinscak
Praktische Übung des Stoffs der Vorlesung „Einführung in die Informatik und Medieninformatik" sowie vertiefte Kenntnisse von digitalen Daten.
Kursinhalte
Kodierung und Kompression von Text-, Bild-, Audio- und Videodateien
Grundlagen der menschlichen Wahrnehmung
Formale Grammatiken und Automaten, Reguläre Ausdrücke
Repräsentation von Daten im Computer
Zahlensysteme und Operationen auf Binärdaten
Allgemeines
Die Übung vertieft den Stoff der Vorlesung „Einführung in die Informatik und Medieninformatik" und geht auf praktische Anwendungen der in der Vorlesung vorgestellten Konzepte ein. Die regelmäßige, erfolgreiche Bearbeitung von Übungsaufgaben ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausur zur Vorlesung. Inhalte der Übung sind ebenfalls Klausurstoff.
- Trainer/in: Franziska Hertlein
- Trainer/in: Raphael Wimmer
Leiter der Übung: Dr. Georg Köglmeier
Nach einer allgemeinen Einführung in die Paläographie, die Lehre von der Schrift, ihren Erscheinungsformen und Funktionen in den einzelnen Epochen, werden handschriftliche archivalische Quellen aus der Kommunalverwaltung in Bayern in der Frühen Neuzeit gelesen und inhaltlich erschlossen. Die Teilnehmer sollen dabei paläographische Kenntnisse erwerben oder vertiefen und einen Einblick in die Geschichte der Kommunalverwaltung gewinnen.
Die Transkription handschriftlicher Texte wird mittlerweile bedeutend erleichtert durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die – in Form des Programms bzw. der Plattform Transkribus – auch in dieser Übung verwendet werden soll. Dies ermöglicht es, umfangreichere Texte zu bearbeiten. Dennoch müssen paläographische Kenntnisse vorliegen, um die Übertragungen, die nach wie vor nicht fehlerfrei sind, ggf. zu korrigieren.
Im Rahmen der Übung soll auch ein Archiv besucht werden.
- Trainer/in: Georg Köglmeier
Es werden analog zur Grundvorlesung Mikrobiologie (VVZ-Nr. 54 121) die
folgenden Themenkomplexe anhand von Übungsaufgaben besprochen:
Zytologie, Wachstum, Molekularbiologie, Metabolismus, Systematik.
- Trainer/in: Annett Bellack
- Trainer/in: Florian Mayer
- Trainer/in: Britt Morawetz
Herzliche Willkommen zur Übung Statistik II!
Wir treffen uns wöchentlich am Donnerstag, 14 - 16 Uhr (c.t.), unter folgendem Link:
https://uni-regensburg.zoom.us/j/8728207595?pwd=cDl5bC81ZUFPenhFams1bWJ3bE1Vdz09
Los geht es am 15.04. mit einer kurzen organisatorischen Einführung. Erklärt wird R. Wer dieses Programm schon heruntergeladen bzw. damit gearbeitet hat, muss nicht zu diesem Termin erscheinen.
Bei Fragen: mario.frei@ur.de
Beste Grüße
Mario
- Trainer/in: Mario Frei
Im 16. Jahrhundert erlebte Europa eine düstere Phase, die von intensiven Hexenverfolgungen geprägt war. Dieses Zeitalter, das durch soziale, religiöse und politische Unruhen gekennzeichnet war, schuf einen fruchtbaren Boden für die Ausbreitung von Hexenverfolgungen. Die Grafschaft Werdenfels (Teil des heutigen Landkreises Garmisch-Partenkirchen) war im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl ein Zentrum der Hexenverfolgungen am Ende des 16. Jahrhunderts in Südostdeutschland. In der Übung sollen am Beispiel der Hexenprozesse der Grafschaft Werdenfels unterschiedliche Aspekte der Hexenverfolgungen erarbeitet und mit den Befunden aus anderen Regionen verglichen werden. Dazu werden ausgewählte Quellen, wie z. B. die Urgichten der Werdenfelser Hexenprozesse, transkribiert und bearbeitet.
Die Teilnehmer:innen der Übung erhalten einen Überblick zum Themenkomplex Hexenverfolgungen in der Frühen Neuzeit, dem aktuellen Forschungsstand und den Deutungsversuchen. Dabei können sie paläographische Kenntnisse erwerben oder diese vertiefen.- Trainer/in: Franziska Strobel
Das Konzept der ‚Citizenship‘ ist ein äußerst vielseitiges, dynamisches und multidimensionales Konstrukt. Seine Popularität in der Wissenschaft und darüber hinaus, erlangte die Lehre von der Staatsbürgerschaft durch die theoretische Konzeption Thomas H. Marshalls, der von einer Trias aus bürgerlichen, politischen und sozialen Rechten ausging, durch die er legitime Ungleichheit zu begründen suchte. In den aktuellen wissenschaftlichen Debatten über ‚Citizenship‘ wird allerdings oft eine Erweiterung um weitere Rechte wie ‚kulturelle Rechte‘ oder ‚Gender Rechte‘ gefordert. Andere wiederum sehen bereits das Ende der klassischen nationalstaatlichen Staatsbürgerschaft gekommen und postulieren eine kosmopolitische Variante. Ziel dieses Kurses ist es, ausgehend von den Überlegungen Thomas H. Marshalls, die Entwicklungen und Veränderungen dieser Theorie herauszuarbeiten und zu diskutieren inwieweit die klassische Trias der Staatsbürgerrechte erweitert werden sollte bzw. ob dieses Konzept nicht von Grund auf bereits überholt ist. Dabei soll ein besonderer Fokus auf einer interkulturellen Perspektive liegen. Hierzu werden in kursorischer Lektüre unter anderem Texte von Thomas H. Marshall, Will Kymlicka, Ralf Dahrendorf und Wolfgang Welsch bearbeitet.
- Trainer/in: William Martin Funke
- Trainer/in: Politische Philosophie
Dienstag, 14-16 Uhr, Veranstaltungsnummer D-33200
In der Übung soll die Frühgeschichte Bayerns ab dem 6. Jahrhundert, die Zeit, in der das Land Bayern, das Volk der Bayern und die Herrschaft der Agilolfinger, das sog. ältere bayerische Stammesherzogtum, erstmals in schriftlichen Quellen genannt werden, untersucht werden. Dazu werden v.a. historiographische Quellen, Chroniken und Annalen, aber auch hagiographische Quellen herangezogen und kritisch ausgewertet. Die Teilnehmer sollen damit nicht nur einen Einblick in einen Abschnitt der bayerischen Geschichte bekommen, sondern auch die besonderen Merkmale einer Quellengruppe und die sich daraus ergebenen Anforderungen für ihre Auswertung kennenlernen.
Die Quellen aus dem frühen Mittelalter sind in Latein. In der Übung wird jedoch vorzugsweise mit Übersetzungen gearbeitet.
Die Übung findet in Form von Zoom-Konferenzen statt.
Als Leistungsnachweis werden gefordert: regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit, Anfertigung von Hausaufgaben.
Dr. Georg Köglmeier
- Trainer/in: Georg Köglmeier
- Trainer/in: Caroline Märzweiler
Hector Berlioz’ Grand traité d’instrumentation et d’orchestration (1843) ist die mit weitem Abstand prominenteste Instrumentationslehre des 19. Jahrhunderts und gilt spätestens seit der durch Richard Strauss überarbeiteten Fassung (Instrumentationslehre von Hector Berlioz, 1905) als das Kompendium zur Orchestrierung schlechthin. Gleich vorweg: Ziel dieser Übung ist es keineswegs, den Teilnehmern eine Anleitung zur Instrumentierung im Sinne kompositorischen Handwerks zu geben. Berlioz’ und Strauss’ Ausführungen werden hier nicht als definitive Erkenntnisse zur Orchesterbehandlung verstanden, sondern als Dokumentation einer Klangästhetik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die sich Früherem und Späterem gegenüberstellen lässt. Die antreibende Frage ist, wie sich in Instrumentationslehren der Blick auf die Orchesterverwendung verändert hat bzw. wo Kontinuitäten herrschen. Dazu erschließen wir uns das reichhaltige Angebot an Instrumentationslehren vom 19. bis hinein ins 21. Jahrhundert – mit Autoren, die oftmals ähnlich prominent waren wie Berlioz –, ziehen Vergleiche und sehen, wie sich das Komponieren für Orchester im Laufe der Zeit gewandelt hat.
- Dozent: Michael Braun
Die Digital Humanities gewinnen in den Geschichtswissenschaften zunehmend an Bedeutung. Diese Übung verknüpft daher die traditionelle historische Quellenarbeit in Archiven mit der Anwendung einer relationalen Datenbank und dem Graphdatenbankprogramm Neo4J. Nach einer einführenden Phase zu relationalen Datenbanken und Neo4J sollen die Teilnehmer:innen anhand archivalischer Quellen zur jüdischen Gemeinde von Floß in die bestehende Datenbank "Prosopographische Datenbank jüdischer Personen in der Frühen Neuzeit" eingebunden und veröffentlicht werden.
Diese praktische Übung ermöglicht es den Kursteilnehmer:innen, einen Beitrag zur Erforschung der jüdischen Gemeinden in der Frühen Neuzeit im heutigen Bayern zu leisten. Dabei setzen sie sich sowohl mit Themen wie jüdischer Genealogie, Onomastik (Namenskunde) und Prosopographie auseinander und erwerben/vertiefen ihre paläographischen Fähigkeiten. Gleichzeitig erwerben sie ein solides Fundament im Umgang mit relationalen Datenbanken in der Geschichtswissenschaft. Dieser interdisziplinäre Ansatz ermöglicht es den Studierenden, nicht nur ihre technischen Fähigkeiten zu verbessern, sondern auch ein tieferes Verständnis für die komplexe Geschichte der jüdischen Gemeinden in der Frühen Neuzeit zu entwickeln. Vorkenntnisse in den Digital Humanities sowie im Transkribieren von frühneuzeitlichen Handschriften sind nicht zwingend notwendig.- Trainer/in: Franziska Strobel
- Trainer/in: Gerson Brea
- Trainer/in: Politische Philosophie
Seit langem spricht man vom „technischem Zeitalter” und versteht den Menschen als „homo faber”. Neuerdings macht auch die Rede vom „homo digitalis” die Runde. In der Tat: keine Politik und keine Lebensform, keine Gesellschaft und keine Kultur scheint sich heutzutage dem Fortschritt der Technik entziehen zu können. Wäre damit gegenwärtig die Technik das interkulturelle Verbindende? Sorgt sie für Transformationen der politischen und privaten Sphären? Oder ist sie vielmehr ein europäisches, westliches Ereignis, das nicht nur die Zerstörung fremder Kulturen vorantreibt, sondern auch wesentlich zu einer „neoliberalen Psychopolitik” beiträgt?
Die Übungsveranstaltung beschäftigt sich in kursorischer Lektüre mit Schlüsseltexten, die versuchen, die Relation zwischen Technik, Kultur und Politik neu auszuloten. Zur Sprache kommen dabei Autoren und Autorinnen wie Hannah Arendt, Herbert Marcuse, Enrique Dussel und Byung-Chul Han.
- Trainer/in: Gerson Brea
- Trainer/in: Politische Philosophie
- Trainer/in: Brigitte Gutbrodt
- Trainer/in: Sebastian Pößniker
- Trainer/in: Michael Zimmermann
- Trainer/in: Alisa Langlitz
Warum machen Leute überhaupt Urlaub? Während Reisen und Migration schon seit Jahrtausenden fester Bestandteil menschlichen Lebens sind, handelt es sich beim Phänomen des Tourismus um ein Produkt der Moderne. Erst im 19. Jahrhundert schafften technologische Innovationen wie die Eisenbahn oder der Telegraf die infrastrukturellen Voraussetzungen für einen strukturierten und oftmals kommerziell gesteuerten Tourismus, während gleichzeitig die Schattenseiten von Industrialisierung und Urbanisierung das Bedürfnis bürgerlicher Schichten nach außerstädtischer Erholung wachsen ließen. In den Zwischenkriegsjahren wandelte sich der Tourismus dann zu einem Massenphänomen, welches nicht zuletzt vom Nationalsozialismus stark instrumentalisiert wurde. Und auch im geteilten Deutschland des Kalten Kriegs blieb Tourismus zutiefst politisch: In der DDR organisierten staatliche Organisationen wie der FDGB-Feriendienst oder die FDJ den Tourismus nach ideologischen Prämissen, während im Westen die zunehmend obligatorischen Sommerurlaube in Italien oder Spanien eine bedeutende Rolle im Wandel der jungen Bundesrepublik zu einer Konsum- und Freizeitgesellschaft spielten. Heute steht der ausufernde „Jetset“-Tourismus einerseits für die global vernetzte Welt kosmopolitischer Eliten, gleichzeitig jedoch auch für rapide wachsende soziale Ungleichheiten und ökologischen Frevel – zumindest bis Corona.
Diese Übung befasst sich mit dem Phänomen des Tourismus aus historischer Perspektive. Weshalb entstand der Tourismus ausgerechnet im 19. Jahrhundert, und welche strukturellen Rahmenbedingungen waren hierfür notwendig? Welche politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Funktionen erfüllte der Tourismus, und inwiefern veränderte er sowohl Gesellschaften als auch die touristischen Räume selbst? Und wie entwickelten sich diese Dynamiken im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts? Diesen Fragen nähern wir uns anhand von aktueller Forschungsliteratur sowie einer Vielzahl abwechslungsreicher Quellen wie beispielsweise Reiseführern, Postkarten und Werbefilmen an.
Hinweis zum digitalen Ablauf: Der Kurs wird (voraussichtlich) digital unterrichtet und ist in fünf größere Themenblöcke gegliedert, was die Vorteile asynchroner und synchroner Lehre miteinander vereint. Jeder Themenblock besteht aus einem einführenden Lehrvideo, einer Auswahl passender Literatur und Quellen, interaktiven asynchronen Diskussionsformaten sowie jeweils einer abschließenden synchronen Zoom-Sitzung. Für jeden dieser fünf Themenblöcke ist eine Arbeitsaufgabe anzufertigen, zu welcher Sie individuelles Feedback erhalten. Die fünf überarbeiteten Aufgaben stellen dann als „Portfolio“ die Bewertungsgrundlage des Kurses dar.
- Trainer/in: Mathias Häußler
- Trainer/in: Tim Kapsreiter
- Trainer/in: Bernadette Mischka
In der Übung zur "Einführung in die Theoretische Philosophie" befassen wir uns mit grundlegenden und klassischen Primärtexten zu den Themen der Vorlesung, also Metaphysik, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Sprachphilosophie, Philosophie des Geistes und Religionsphilosophie. Dadurch wird der Vorlesungsstoff ergänzt und vertieft und es wird die Fähigkeit zu Verständnis und Analyse philosophischer Argumentationen eingeübt. Es wird zu jeder Sitzung ein Übungsblatt zum jeweiligen Text oder Textabschnitt ausgegeben. Wir werden dann in der Übung den jeweils aktuellen Text anhand der im Übungsblatt gestellten Aufgaben strukturieren und erschließen.
Der Kurs findet digital durch Zoom-Videokonferenzen statt.
|
In der Übung zur "Einführung in die Theoretische Philosophie" befassen wir uns mit grundlegenden und klassischen Primärtexten zu den Themen der Vorlesung, also Metaphysik, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Sprachphilosophie, Philosophie des Geistes und Religionsphilosophie. Dadurch wird der Vorlesungsstoff ergänzt und vertieft und es wird die Fähigkeit zu Verständnis und Analyse philosophischer Argumentationen eingeübt. Es wird zu jeder Sitzung ein Übungsblatt zum jeweiligen Text oder Textabschnitt ausgegeben. Wir werden dann in der Übung den jeweils aktuellen Text anhand der im Übungsblatt gestellten Aufgaben strukturieren und erschließen. |
|
| Literatur |
Begleitend zu der Übung wird ein Reader mit den Texten bzw. Textabschnitten zur Verfügung gestellt. |
|---|---|
| Bemerkung |
Hinweise zu Belegbarkeit und FlexNow-Anmeldung finden Sie unter der Vorlesung 31105. |
| Voraussetzungen |
Keine |
| Leistungsnachweis |
4 LP werden für das Bestehen der Vorlesungsklausur vergeben, siehe den Kommentar dort. Für 8 bzw. 9 LP ist zusätzlich die Übung zu belegen. Der Leistungsnachweis in der Übung erfolgt durch Präsentation einer eigenständig erstellten Lösung zu einem der Übungsblätter. |
- Trainer/in: Holger Leuz
Sobald schützenswerte Daten über Rechnernetze ausgetauscht werden, müssen sie gesichert werden. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden neben einem theoretischen Unterbau unterschiedliche Bedrohungen für einzelne Rechner und Kommunikationsnetze sowie entsprechende Gegenmaßnahmen diskutiert und erläutert. Die Studierenden sollen dabei erlernen, wie aktuelle Angriffe und Sicherheitsmechanismen funktionieren und welche Gegenmaßnahmen sich in bestimmten Situationen eignen.
- Trainer/in: Karin Binder
- Trainer/in: Kesdogan Technik
„Jemandem etwas erzählen“ ist ein Prototypus mündlicher Kommunikation, der normalerweise monologisch und nicht medial vermittelt abläuft. Das Ergebnis des Erzählens, die Erzählung, wird normalerweise nicht verschriftlicht. „Erzählungen“ werden aber auch literarische Kurzformen wie Märchen, Anekdote, Kurzgeschichte, Fabel genannt. In der Lehrveranstaltung soll einerseits die sprachwissenschaftliche Analyse beider Erzählungstypen geübt, andererseits sollen die Besonderheiten der mündlichen Erzählung und der literarischen Erzählung im gegenseitigen Vergleich
herausgearbeitet werden. Dies soll durch Impulsreferate der Teilnehmer/innen vonstatten gehen. Um an originale mündliche Erzählungen zu kommen und diese analysieren zu können, wird es nötig sein, dass die Teilnehmer/innen originale mündliche Erzählungen auf Tonträger aufzeichnen und der wissenschaftlichen Diskussion zugänglich machen.
Im Kurs erweitern die Teilnehmer ihre Sprachkompetenz und Kommunikationsfähigkeiten in der ukrainischen Sprache. Zudem wird ihre soziokulturelle Kompetenz durch kulturelle Beispiele und Vergleiche mit anderen slawischen Sprachen vertieft.
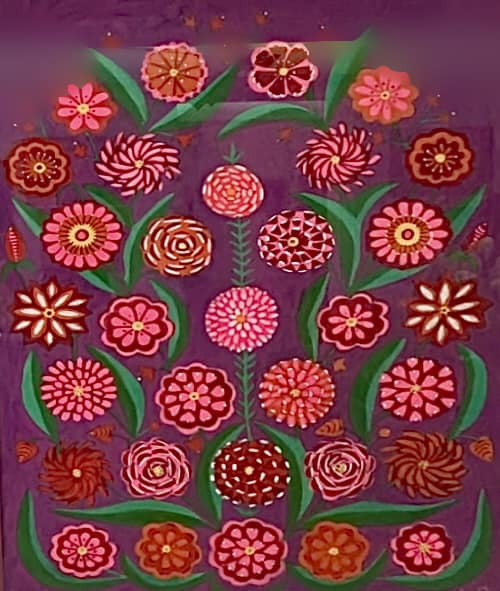
- Trainer/in: Oksana Turkevych
Umweltlernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE, Education for Sustainable Development, ESD) sollen bei den Schüler*innen Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt entwickeln und ihr Wissen über die komplexe und wechselseitige Abhängigkeit zwischen Mensch und Umwelt erweitern (vgl. LPPLUS 2014). Wie Schülerinnen und Schüler sich Wissen über Umwelt, deren komplexe Ursachen sowie Auswirkungen aneignen können und sich mit Normen und Werten auseinandersetzen, um ihre Umwelt zukunftsfähig mitgestalten und schützen zu können, soll im Seminar beleuchtet werden.
- Trainer/in: Christian Gößinger
Kursbeginn: Mi., 14. Juni 2017 - 26. Juli 2017 (= 2. Semesterhälfte)
von 12:30 Uhr - 14 Uhr in R 008
W / P für SP 8 (ab 5. Sem.)
(2 Credits)
Am 13.12.2016 ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 10 Jahre alt geworden. In dieser relativ kurzen Zeit hat die Konvention viel bewegt. Wenn Universität und OTH neue automatische Türen einbauen, ist dies ebenso eine Folge der Konvention wie die akustischen Fahrplanauskünfte an neuen Regensburger Bushaltestellen. Dennoch beklagen der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die deutsche Monitoring-Stelle gravierende Umsetzungsdefizite. Folgt man dem Ausschuss, ist das geltende deutsche Betreuungsrecht ebenso konventionswidrig wie der Ausschluss bestimmter geistig Behinderter vom Wahlrecht zum Deutschen Bundestag oder die zwangsweise Unterbringung Demenzkranker in Heimen.
In der Veranstaltung werden die Rechte der Konvention vom Diskriminierungsverbot über die Barrierefreiheit bis hin zur inklusiven Schulbildung behandelt. Außerdem wird es um die Überwachungsmechanismen der Konvention gehen. Im Konversationsübungsteil sollen vor allem Dokumente des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen analysiert werden.
Im Nebenfach/2. Hauptfach Öffentliches Recht kann diese Veranstaltung als "ergänzende Veranstaltung zum europäischen oder internationalen Recht" eingebracht werden. Alternativ ist im Nebenfach/2. Hauptfach Öffentliches Recht a.F. eine Anrechnung als "KÜ: Ausgewählte Probleme des Menschenrechtsschutzes" möglich.
Weitere Details stehen im online-Vorlesungsverzeichnis.
- Trainer/in: Margit Berndl
- Trainer/in: Robert Uerpmann-Wittzack
Vladimir Putin hat den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch damit legitimiert, dass Russ*innen und Ukrainer*innen ein Volk seien, das die Kyjiver Rusʼ als gemeinsames Erbe teile. Noch am 21. Februar 2022, drei Tage vor dem Angriff auf die Ukraine, betonte er die „Bluts- und Familienbande“, die die Ukrainer und die Russen angeblich miteinander verbänden. Die Geschichte ist komplizierter, als es Vladimir Putin wahrhaben will, der historische Narrative benutzt, um den Ukrainer*innen Souveränität, Geschichte und Identität abzusprechen. Putin verschweigt, dass das von Ukrainer*innen bewohnte Gebiet seit dem Mittelalter eng mit dem übrigen Europa verbunden war. Es gehörte länger zu Polen-Litauen, als es Bestandteil des Zarenreiches beziehungsweise der Sowjetunion war. Anders als es die Ideologen der „Russischen Welt“ suggerieren, kann von einer durchlaufenden Kontinuität der russisch-ukrainischen Zusammengehörigkeit seit der Christianisierung der Kyjiver Rusʼ im Jahr 988 bis heute keine Rede sein. Erst seit 1654 ist die Geschichte der beiden Länder wieder enger miteinander aufeinander bezogen. Die Vereinbarung von Perejaslav 1654, in der sich die ukrainischen Kosaken dem russischen Zaren unterstellten, gilt als der Beginn der Inkorporation der Ukraine nach Russland.
An Schlüsselmomenten der russischen und ukrainischen Geschichte in der Vormoderne wird die Übung zeigen, dass diese Verbindung weder konfliktfrei noch alternativlos, sondern es hat auch andere Möglichkeiten der Kooperation gegeben hat. Die Übung möchte dazu anregen, Diskurse über Russland und die Ukraine als „Brudervölker“ kritisch zu hinterfragen.
Vladimir Putin also legitimised the Russian war of aggression on Ukraine by claiming that Russians and Ukrainians are “one people” who share the Kyiv Rusʼ as a common heritage. As recently as 21 February 2022, three days before the attack on Ukraine, he emphasized the "blood and family ties" that supposedly bind Ukrainians and Russians together. The story is more complicated than Vladimir Putin wants to admit. Putin fails to mention that the territory inhabited by Ukrainians has been closely connected to the rest of Europe since the Middle Ages. It belonged to Poland-Lithuania longer than it was part of the Tsarist Empire or the Soviet Union. Contrary to what the ideologists of the "Russian world" suggest, there can be no question of a continuity of Russian-Ukrainian unity from the Christianization of the Kyiv Rusʼ in 988 until today. Only since 1654 has the history of the two countries again been more closely related. The agreement of Perejaslav in 1654, in which the Ukrainian Cossacks subordinated themselves to the Russian Tsar, is considered the beginning of the incorporation of Ukraine into Russia.
Using key moments in Russian and Ukrainian history in the pre-modern period, the seminar will show that this connection was neither conflict-free nor without alternative. The course aims to encourage critical questioning of discourses about Russia and Ukraine as "brother nations".
Literatur: Kappeler, Andreas: Ungleiche Brüder. Russen und Ukrainer vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Originalausgabe. München 2022 (= C.H. Beck Paperback, Bd. 6284); Plochij, Serhij Mykolajovyč: Die Frontlinie. Warum die Ukraine zum Schauplatz eines neuen Ost-West-Konflikts wurde. Hamburg 2022.
- Trainer/in: Julia Herzberg
Gegenstand des Seminars ist die Auseinandersetzung mit einer nachhaltigeren Entwicklung der Weltgesellschaft für eine sozial-ökologische Transformation. Die Studierenden erwerben Grundkenntnisse in Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), in Kombination mit kritischen und postkolonialen Perspektiven auf die Nachhaltigkeitsthematik. Im Fokus stehen aktuelle Ungleichheitsverhältnisse, bspw. bestehende nationale Bildungsungleichheiten sowie globale Ungleichheiten. Im Seminar wird eine Auseinandersetzung mit Migration und Rassismus in Bildungsprozessen angestrebt. Eine globale Perspektive wird im Hinblick auf Klimagerechtigkeit eingenommen und u.a. der Zusammenhang von Klimawandel und Gesundheit diskutiert.
- Trainer/in: Johanna Weselek
- Trainer/in: Jörg Zedler
Lässt sich für einen möglichst gelingenden Unterricht alles planen?! Alles lässt sich vielleicht nicht planen, aber ich komme meinem Ziel, einen für alle Kinder möglichst gewinnbringenden Unterricht zu gestalten, mit einer guten Vorbereitung näher! Hier werden im Seminar aufbauend auf der Einführungsvorlesung verschiedene Aspekte der Planungsarbeit, der Durchführung und der Reflexion bearbeitet.
- Trainer/in: Christian Gößinger
|
Lässt sich für einen möglichst gelingenden Unterricht alles planen?! Alles lässt sich vielleicht nicht planen, aber ich komme meinem Ziel, einen für alle Kinder möglichst gewinnbringenden Unterricht zu gestalten, mit einer guten Vorbereitung näher! Hier werden im Seminar aufbauend auf der Einführungsvorlesung verschiedene Aspekte der Planungsarbeit, der Durchführung und der Reflexion bearbeitet. |
- Trainer/in: Christian Gößinger
Der Begriff der Usability suggeriert, dass Medien vor allem dann gut funktionieren, wenn sie als Medientechnologie nicht sichtbar werden und sich nahtlos in den Alltag einfügen. Die Computerkultur operiert häufig mit Begriffen wie ‚ubiquitous computing‘ oder ‚clouds‘, die Medientechnologie und die von ihr benötigte Infrastruktur als immateriell erscheinen lassen. Dieses Seminar diskutiert eine kritische Perspektive auf diese Immaterialisierungsdiskurse und stellt grundsätzlich in Frage, dass sich Medientechnologien verstecken sollten. Es soll die ‚Sperrigkeit‘ der Medien herausgestellt werden, ihre Momente der Unbrauchbarkeit und Irritation, die in unterschiedlichen Aspekten zum Ausdruck kommen: in ungebrauchten Technologien, die sich nicht durchgesetzt haben und niemals in den Alltag integriert wurden, in einer ‚culture of repair‘ (Jackson), die auf dem Bewusstsein für den ständigen Zusammenbruch von Computerinfrastruktur und der Mühen ihrer Aufrechterhaltung basiert, vor allem aber in dem Konzept der Dekonvergenz (vgl. Balbi/Peil/Sapiero), das eine Bewegung des Auseinanderdriftens von Anwendungen statt einer konvergenten Verschmelzung diskutiert und auf die Bruchstellen von Konvergenzprozessen hinweist. Dekonvergenz öffnet den Blick für die vielfältigen Anforderungen und Zumutungen einer neuen Medienkultur: die Synchronisierung von Geräten, das Management von Speichervorgängen gegen permanent drohenden Datenverlust, die Organisation der zahllosen Zugangsmöglichkeiten zu Mediengeräten wie dem Fernsehen, die aus der einfachen Fernsehrezeption eine Wissenschaft für sich gemacht hat. All diese Aspekte machen überdeutlich, dass es Medien gibt und sie alles andere als selbstverständlich und unsichtbar sind. Unusability will damit auf unterschiedlichen Ebenen die Reduktion von Medienhandeln auf Brauchbarkeit in Frage stellen, eine positive Definition von Sperrigkeit liefern und die Aufmerksamkeit auf eine störende, die Erfahrung irritierende und die Wahrnehmung verschiebende Dimension des Medienhandelns richten.
Grundlage des erfolgreichen Abschlusses des Seminars sind Anwesenheit und Beteiligung an der Seminardiskussion, Referat und Hauarbeit.
- Trainer/in: Herbert Schwaab
Das mediale Phänomen Star Trek fasziniert weltweit Generationen von Zusehern. Aus einer US-amerikanischen Low-Budget Science-Fiction-Produktion der späten 1960er Jahre entwickelte sich über die Jahrzehnte eines der größten und erfolgreichsten medialen Franchise-Unternehmen weltweit. Woher aber kommt diese Faszination für „Das Weltall, unendliche Weiten“, für die Erforschung von „Gegenden, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat“? Ebenso wie die Schauspieler in der Reihe begeben auch wir uns auf die Suche. Gemeinsam hinterfragen wir, inwieweit hier die Zukunft zur Projektionsfläche kultureller Wertigkeiten, gesellschaftlicher Diskurse und damit einhergehend von sozialen Wandlungsprozessen wird. Welche Utopien werden in STAR TREK kreiert, wo liegt ihr historischer Bezugsrahmen und welche Kritik wurde damit an realen politischen Verhältnissen geübt?
Nach einer Einführung in die Begrifflichkeiten von Science Fiction und Utopie erforschen wir zudem die Darstellung des zukünftigen „Alltags“ auf der „USS Enterprise“. Auch die Beschäftigung mit Fankulturen im Rahmen von sogenannten Star Trek-Conventions und international organisierten Treffen wird Bestandteil des Seminares sein.
- Trainer/in: Barbara Wittmann
Auch aufgrund seiner kontinentalen Randlage steht das mittelalterliche
Nordeuropa vielleicht weniger im Fokus des historischen Interesses als
andere Regionen des Kontinents. Zu Unrecht, denn im Frühmittelalter
entstand in Skandinavien mit der Wikingergesellschaft eine komplexe
Sozialstruktur. Mit ihrer Expansion nach Nordostengland, Irland, Island
und Grönland sowie in den Nordosten Rußlands bis zur Jahrtausendwende
besiedelten und kolonisierten die frühmittelalterlichen Skandinavier
große Teile Nordeuropas und schufen dabei auch weitreichende
Handelsverbindungen. In der Begegnung mit dem Christentum begann sich
ihre Gesellschaft nach 1000 langsam, aber nachhaltig zu wandeln und in
der Folge entstanden im Hochmittelalter christlich legitimierte,
skandinavische Königreiche, die die Integration Skandinaviens in das
christliche Europa markierten.
In der Vorlesung wird ein Überblick über Gesellschaft, Wirtschaft und
Kultur der frühmittelalterlichen Skandinavier und den Wandel der
skandinavischen Gesellschaft durch die Christianisierung gegeben.
Hierbei wird es um Herrschaftsvorstellungen und religiöse Praxis der
Wikinger gehen, ebenso wie um ihr technisches Wissen und ihre
handwerklichen Fähigkeiten. Betrachtet werden außerdem
Bevölkerungsentwicklung, Siedlungsstrukturen, Landwirtschaft und Handel.
Ausgiebig diskutiert werden auch die bei diesem Thema besonders
evidenten Probleme historischer Untersuchung, nämlich der grundsätzliche
Mangel an Schriftquellen, der die Auswertung von Sachquellen – und
damit die Beschäftigung mit den Methoden der Archäologie – unabdingbar
macht, die christlich geprägte Fremdwahrnehmung der Wikinger durch
westeuropäische Chronisten sowie die ebenfalls bereits christlich
geprägte Selbstwahrnehmung in den erst während der Christianisierung in
Skandinavien entstandenen Sagas und Chroniken.
- Trainer/in: Ulf Ewert
- Trainer/in: Sonja Neumeier
- Trainer/in: Frieda Walter
Ihre Anmeldung senden Sie bitte per E-Mail an: zentrum.hochschuldidaktik@ur.de
Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:
- Nachweis über Zertifikat Hochschullehre oder didaktische Fortbildungen im Umfang von 120 AE
- Formlose Erklärung über die Lehrtätigkeit im Umfang von mindestens 2 SWS im kommenden Semester
- Trainer/in: Zentrum Hochschuldidaktik
- Trainer/in: Stephanie Rottmeier
Ihre Anmeldung senden Sie bitte per E-Mail an: zentrum.hochschuldidaktik@ur.de
Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:
- Nachweis über Zertifikat Hochschullehre oder didaktische Fortbildungen im Umfang von 120 AE
- Formlose Erklärung über die Lehrtätigkeit im Umfang von mindestens 2 SWS im kommenden Semester
- Trainer/in: Zentrum Hochschuldidaktik
- Trainer/in: Thomas Neger
- Trainer/in: Stephanie Rottmeier
Ihre Anmeldung senden Sie bitte per E-Mail an: zentrum.hochschuldidaktik@ur.de
Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:
- Nachweis über Zertifikat Hochschullehre oder didaktische Fortbildungen im Umfang von 120 AE
- Formlose Erklärung über die Lehrtätigkeit im Umfang von mindestens 2 SWS im kommenden Semester
- Trainer/in: Zentrum Hochschuldidaktik
- Trainer/in: Thomas Neger
- Trainer/in: Stephanie Rottmeier
Ihre Anmeldung senden Sie bitte per E-Mail an: zentrum.hochschuldidaktik@ur.de
Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:
- Nachweis über Zertifikat Hochschullehre oder didaktische Fortbildungen im Umfang von 120 AE
- Formlose Erklärung über die Lehrtätigkeit im Umfang von mindestens 2 SWS im kommenden Semester
- Trainer/in: Zentrum Hochschuldidaktik
- Trainer/in: Thomas Neger
- Trainer/in: Stephanie Rottmeier
Mi 16-18 Uhr
PT 2.0.9.
Infrastrukturen ermöglichen die (Neu-)ordnung von Räumen. Sie mobilisieren Ressourcen und Arbeitskraft in großem Umfang und verweisen auf die jeweils zeitgenössischen Herrschaftsverhältnisse und Zukunftsvorstellungen. Durch sie lassen sich lange Distanzen überwinden sowie Mangel und Überfluss an Menschen und Gütern ausgleichen. Sie entwickeln auf diese Weise eine starke gesellschaftliche Gestaltungskraft. Die Übung widmet sich diesen Aspekten in Bezug auf das Russländische Reich. In einem ersten Schritt stehen Infrastrukturen als Integrations- und Herrschaftsmedien im Mittelpunkt. Die Übung fragt, wie es dem Zarenreich gelang, militärische, politische oder ökonomische Überlegenheit gegenüber der indigenen Bevölkerung in Sibirien und benachbarten Herrschaftsräumen in dauerhafte Macht zu verwandeln. Wie wurden schwer erreichbare Gebiete in der arktischen Tundra, in der Steppe oder auf Kamčatka erschlossen, welche technischen, kommunikativen und administrativen Mittel standen zur Verfügung, um militärische Stützpunkte oder neu gegründete Städte zu versorgen? In einem zweiten Schritt wird der Zusammenhang von Infrastrukturen und sozialen Praktiken untersucht. Inwieweit trugen sie zur Mobilität und Migration sowie Wissensaustausch und Handel bei? Wie wandelten oder verfestigten sich durch sie soziale Hierarchien?
Während die bisherige Forschung insbesondere Infrastrukturen im 19. und 20. Jahrhundert untersucht hat, stellt die Übung „vormoderne“ Infrastrukturen in den Mittelpunkt. Die Bedeutung von Seewegen, Häfen, (Wasser-)Straßen sowie dem Postwesen stehen im Zentrum. Mit diesen Themen bewegt sich die Übung an der Schnittstelle von Technik-, Wirtschafts- und Umweltgeschichte, in die die Übung gleichfalls Einblicke geben wird.
Literatur:
Dittmar Dahlmann, Sibirien. Vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Paderborn 2009.
Jens Ivo Engels; Julia Obertreis (Hrsg.), Themenheft Infrastrukturen von Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte 1/2007.
Sebastian Gießmann, Die Verbundenheit der Dinge. Eine Kulturgeschichte der Netze und Netzwerke, Berlin 2014.
Per Högselius; Arne Kaijser; Erik van der Vleuten, Europe’s Infrastructure Transition. Economy, War, Nature. Basingstoke 2015.
Nancy Shields Kollmann, The Russian Empire 1450-1801. Oxford 2017.
Dirk van Laak, Infra-Strukturgeschichte, in: Geschichte und Gesellschaft 27, 2001, 367–393.
Leistungsnachweise: Mitarbeit und Referat
- Trainer/in: Julia Herzberg
- Trainer/in: Agnes Rugel
- Trainer/in: Sandra Reimann
Schwurbeleien, Querdenken, Fake News und Verschwörungen sind spätestens seit dem Erstarken des Populismus in Europa und den USA wieder in aller Munde. Wenn die Lügenkaskaden auf Donald Trumps Twitter-Account, die Leugnung des menschengemachten Klimawandels oder andere antidemokratische Konspirationen derzeit in der Öffentlichkeit diskutiert werden, dann hat das damit zu tun, dass diese Formen des Wissens seit den 1950er Jahren nicht mehr als legitim gelten, aber in unserem digitalen Zeitalter umso schnell verbreitet werden und sichtbar sind. Konspirationen blicken jedoch auf eine lange Tradition zurück, die von antisemitischen Fiktionen und alternativen Erzählungen über die Mondlandung bis hin zu den pseudowissenschaftlichen Theorien der Prä-Astronautik reicht.
Mit Blick auf die spanische Moderne und Postmoderne unterscheiden wir im Seminar zwischen zwei Kategorien: den Theorien selbst und ihrer bewussten Inszenierung in der Fiktion. In diesem Sinne wird der erste Schritt des Seminars den Verschwörungstheorien selbst gewidmet sein, die in der spanischen Gesellschaft kursieren. Anhand einiger Beispiele werden wir versuchen, mithilfe narratologischer Ansätze zu analysieren, wie diese Erzählungen von Paralleluniversen genau funktionieren und dabei feststellen, dass ihre Argumentationsstruktur über die Jahrhunderte nahezu unverändert geblieben ist: sie operieren mit Metaphern, erzählen ihre Geschichte meist vom Ende her und versuchen eine kleine Gruppe oder einzelne Individuen für komplexe Sachverhalte verantwortlich zu machen. In einem zweiten Schritt konzentrieren wir uns auf Serien, Filme und Literaturen, die Verschwörungsszenarien im Rahmen von Fiktionen inszenieren. Dieses Phänomen erfreut sich derzeit in der spanischen Kunst und Kultur einer besonderen Beliebtheit.
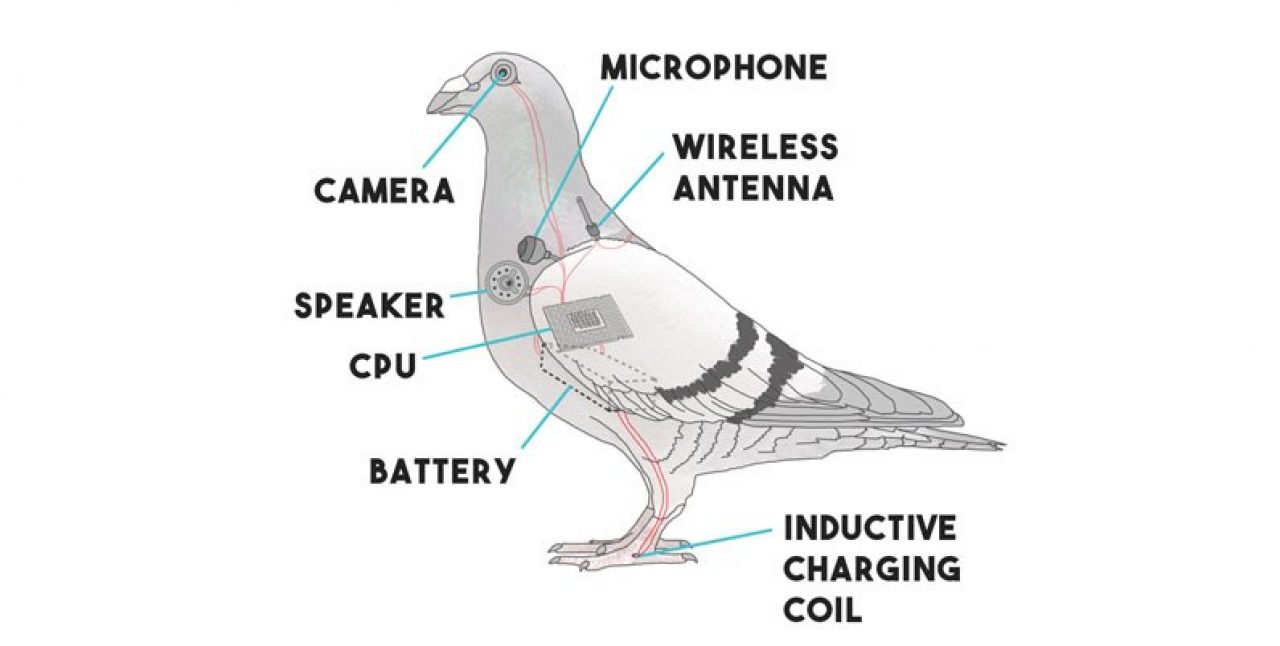
- Trainer/in: Niklas Schmich
Allgemeines: Die Veranstaltung baut inhaltlich auf dem Grundkurs 3D-Modellierung aus den vorangehenden Sommersemestern auf. Es wird die Open-Source-Software Blender 3D verwendet, um anspruchsvolle Arbeiten im 3D-Raum vorzunehmen. Anhand anschaulicher Beispiele bzw. Aufgaben werden praktische Übungen durchgeführt, die auf ein visuelles Endprodukt abzielen. Die Vorlesung liefert die theoretischen Hintergründe und nötigen Erläuterungen für die Übungen.
Kursziele: Am Ende des Kurses soll jeder Teilnehmer in der Lage sein, mit Hilfe der im Kurs verwendeten Software komplexere 3-Dimensionale Szenen zu gestalten und Animationen darin auszuführen. Es soll ein Überblick zu weiterführenden Arbeitsweisen, Techniken und Werkzeugen im Bereich von 3D-Programmen vermittelt werden.
Voraussetzungen
- Vorlesung Multimedia Technology
- Grundkenntnisse in Bild- und Videobearbeitung
- Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen
- Grundkurs 3D-Modellierung oder ausreichend Erfahrung mit Blender3D
Leistungsnachweis:
- Abgabe von Übungsaufgaben im Laufe des Semesters – Übungsaufgaben müssen bestanden werden
- Erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit
- Die Kursnote ergibt sich aus der Bewertung der Projektarbeit.
Lerninhalte:
Der Vertiefungskurs bietet Einblicke in fortgeschrittene Themen der 3D-Gestaltung und wird von praktischen Übungen begleitet. Behandelt werden folgende Themenfelder:
- Vertiefung der Themen aus dem Grundkurs
- Modellierung und Animationstechniken für Fortgeschrittene
- 3D-Objekte in Augmented Reality
- Trainer/in: Martin Brockelmann
Allgemeines: Die Veranstaltung baut inhaltlich auf dem Grundkurs 3D-Modellierung aus den vorangehenden Sommersemestern auf. Es wird die Open-Source-Software Blender 3D verwendet, um anspruchsvolle Arbeiten im 3D-Raum vorzunehmen. Anhand anschaulicher Beispiele bzw. Aufgaben werden praktische Übungen durchgeführt, die auf ein visuelles Endprodukt abzielen. Die Vorlesung liefert die theoretischen Hintergründe und nötigen Erläuterungen für die Übungen.
Kursziele: Am Ende des Kurses soll jeder Teilnehmer in der Lage sein, mit Hilfe der im Kurs verwendeten Software komplexere 3-Dimensionale Szenen zu gestalten und Animationen darin auszuführen. Es soll ein Überblick zu weiterführenden Arbeitsweisen, Techniken und Werkzeugen im Bereich von 3D-Programmen vermittelt werden.
Voraussetzungen
- Vorlesung Multimedia Technology
- Grundkenntnisse in Bild- und Videobearbeitung
- Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen
- Grundkurs 3D-Modellierung oder ausreichend Erfahrung mit Blender3D
Leistungsnachweis:
- Abgabe von Übungsaufgaben im Laufe des Semesters – Übungsaufgaben müssen bestanden werden
- Erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit
- Die Kursnote ergibt sich aus der Bewertung der Projektarbeit.
Lerninhalte:
Der Vertiefungskurs bietet Einblicke in fortgeschrittene Themen der 3D-Gestaltung und wird von praktischen Übungen begleitet. Behandelt werden folgende Themenfelder:
- Vertiefung der Themen aus dem Grundkurs
- Modellierung und Animationstechniken für Fortgeschrittene
- 3D-Objekte in Augmented Reality
- Trainer/in: Martin Brockelmann
Allgemeines: Die Veranstaltung baut inhaltlich auf dem Grundkurs 3D-Modellierung aus den vorangehenden Sommersemestern auf. Es wird die Open-Source-Software Blender 3D verwendet, um anspruchsvolle Arbeiten im 3D-Raum vorzunehmen. Anhand anschaulicher Beispiele bzw. Aufgaben werden praktische Übungen durchgeführt, die auf ein visuelles Endprodukt abzielen. Die Vorlesung liefert die theoretischen Hintergründe und nötigen Erläuterungen für die Übungen.
Kursziele: Am Ende des Kurses soll jeder Teilnehmer in der Lage sein, mit Hilfe der im Kurs verwendeten Software komplexere 3-Dimensionale Szenen zu gestalten und Animationen darin auszuführen. Es soll ein Überblick zu weiterführenden Arbeitsweisen, Techniken und Werkzeugen im Bereich von 3D-Programmen vermittelt werden.
Voraussetzungen
- Vorlesung Multimedia Technology
- Grundkenntnisse in Bild- und Videobearbeitung
- Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen
- Grundkurs 3D-Modellierung oder ausreichend Erfahrung mit Blender3D
Leistungsnachweis:
- Abgabe von Übungsaufgaben im Laufe des Semesters – Übungsaufgaben müssen bestanden werden
- Erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit
- Die Kursnote ergibt sich aus der Bewertung der Projektarbeit.
Lerninhalte:
Der Vertiefungskurs bietet Einblicke in fortgeschrittene Themen der 3D-Gestaltung und wird von praktischen Übungen begleitet. Behandelt werden folgende Themenfelder:
- Vertiefung der Themen aus dem Grundkurs
- Modellierung und Animationstechniken für Fortgeschrittene
- 3D-Objekte in Augmented Reality
- Trainer/in: Martin Brockelmann
Allgemeines: Die Veranstaltung baut inhaltlich auf dem Grundkurs 3D-Modellierung aus den vorangehenden Sommersemestern auf. Es wird die Open-Source-Software Blender 3D verwendet, um anspruchsvolle Arbeiten im 3D-Raum vorzunehmen. Anhand anschaulicher Beispiele bzw. Aufgaben werden praktische Übungen durchgeführt, die auf ein visuelles Endprodukt abzielen. Die Vorlesung liefert die theoretischen Hintergründe und nötigen Erläuterungen für die Übungen.
Kursziele: Am Ende des Kurses soll jeder Teilnehmer in der Lage sein, mit Hilfe der im Kurs verwendeten Software komplexere 3-Dimensionale Szenen zu gestalten und Animationen darin auszuführen. Es soll ein Überblick zu weiterführenden Arbeitsweisen, Techniken und Werkzeugen im Bereich von 3D-Programmen vermittelt werden.
Voraussetzungen
- Vorlesung Multimedia Technology
- Grundkenntnisse in Bild- und Videobearbeitung
- Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen
- Grundkurs 3D-Modellierung oder ausreichend Erfahrung mit Blender3D
Leistungsnachweis:
- Abgabe von Übungsaufgaben im Laufe des Semesters – Übungsaufgaben müssen bestanden werden
- Erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit
- Die Kursnote ergibt sich aus der Bewertung der Projektarbeit.
Lerninhalte:
Der Vertiefungskurs bietet Einblicke in fortgeschrittene Themen der 3D-Gestaltung und wird von praktischen Übungen begleitet. Behandelt werden folgende Themenfelder:
- Vertiefung der Themen aus dem Grundkurs
- Modellierung und Animationstechniken für Fortgeschrittene
- 3D-Objekte in Augmented Reality
- Trainer/in: Martin Brockelmann
Allgemeines: Die Veranstaltung baut inhaltlich auf dem Grundkurs 3D-Modellierung aus den vorangehenden Sommersemestern auf. Es wird die Open-Source-Software Blender 3D verwendet, um anspruchsvolle Arbeiten im 3D-Raum vorzunehmen. Anhand anschaulicher Beispiele bzw. Aufgaben werden praktische Übungen durchgeführt, die auf ein visuelles Endprodukt abzielen. Die Vorlesung liefert die theoretischen Hintergründe und nötigen Erläuterungen für die Übungen.
Kursziele: Am Ende des Kurses soll jeder Teilnehmer in der Lage sein, mit Hilfe der im Kurs verwendeten Software komplexere 3-Dimensionale Szenen zu gestalten und Animationen darin auszuführen. Es soll ein Überblick zu weiterführenden Arbeitsweisen, Techniken und Werkzeugen im Bereich von 3D-Programmen vermittelt werden.
Voraussetzungen
- Vorlesung Multimedia Technology
- Grundkenntnisse in Bild- und Videobearbeitung
- Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen
- Grundkurs 3D-Modellierung oder ausreichend Erfahrung mit Blender3D
Leistungsnachweis:
- Abgabe von Übungsaufgaben im Laufe des Semesters – Übungsaufgaben müssen bestanden werden
- Erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit
- Die Kursnote ergibt sich aus der Bewertung der Projektarbeit.
Lerninhalte:
Der Vertiefungskurs bietet Einblicke in fortgeschrittene Themen der 3D-Gestaltung und wird von praktischen Übungen begleitet. Behandelt werden folgende Themenfelder:
- Vertiefung der Themen aus dem Grundkurs
- Modellierung und Animationstechniken für Fortgeschrittene
- 3D-Objekte in Augmented Reality
- Trainer/in: Anton Alesik
- Trainer/in: Martin Brockelmann
Allgemeines: Die Veranstaltung baut inhaltlich auf dem Grundkurs 3D-Modellierung aus den vorangehenden Sommersemestern auf. Es wird die Open-Source-Software Blender 3D verwendet, um anspruchsvolle Arbeiten im 3D-Raum vorzunehmen. Anhand anschaulicher Beispiele bzw. Aufgaben werden praktische Übungen durchgeführt, die auf ein visuelles Endprodukt abzielen. Die Vorlesung liefert die theoretischen Hintergründe und nötigen Erläuterungen für die Übungen.
Kursziele: Am Ende des Kurses soll jeder Teilnehmer in der Lage sein, mit Hilfe der im Kurs verwendeten Software komplexere 3-Dimensionale Szenen zu gestalten und Animationen darin auszuführen. Es soll ein Überblick zu weiterführenden Arbeitsweisen, Techniken und Werkzeugen im Bereich von 3D-Programmen vermittelt werden.
Voraussetzungen
- Vorlesung Multimedia Technology
- Grundkenntnisse in Bild- und Videobearbeitung
- Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen
- Grundkurs 3D-Modellierung oder ausreichend Erfahrung mit Blender3D
Leistungsnachweis:
- (Abgabe von Übungsaufgaben im Laufe des Semesters – Übungsaufgaben müssen bestanden werden )
- Erfolgreich abgeschlossene Projektarbeit
- Die Kursnote ergibt sich aus der Bewertung der Projektarbeit.
Lerninhalte:
Der Vertiefungskurs bietet Einblicke in fortgeschrittene Themen der 3D-Gestaltung und wird von praktischen Übungen begleitet. Behandelt werden folgende Themenfelder:
- Vertiefung der Themen aus dem Grundkurs
- Modellierung und Animationstechniken für Fortgeschrittene
- 3D-Objekte in Augmented Reality
- Trainer/in: Anton Alesik
- Trainer/in: Martin Brockelmann
In diesem Seminar lernen wir verschiedene Motivationstheorien kennen
Jeden Mittwoch 8- 10 Uhr im PT2.0.5
Das Seminar richtet sich in erster Linie an Psychologiestudierende im Bachelorstudiengang (PSY-M13.2) kann aber auch gerne von Nebenfachsstudierenden (z.B.: EDU-M10.0, EDU-M14.0) und Lehramtsstudierenden (Wahlbereich Modul W5) besucht werden.
Bitte hier auch noch schnell anmelden und dann einfach in der ersten Stunde kommen.
aktuell 30 Personen auf der Nachrückliste
- Dozentin: Nicole Gruber
Umweltlernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE, Education for Sustainable Development, ESD) sollen bei den Schüler*innen Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt entwickeln und ihr Wissen über die komplexe und wechselseitige Abhängigkeit zwischen Mensch und Umwelt erweitern (vgl. LPPLUS 2014). Wie Schülerinnen und Schüler sich Wissen über Umwelt, deren komplexe Ursachen sowie Auswirkungen aneignen können und sich mit Normen und Werten auseinandersetzen, um ihre Umwelt zukunftsfähig mitgestalten und schützen zu können, soll im Seminar beleuchtet werden.
- Trainer/in: Christian Gößinger
- Trainer/in: Veronika Preisinger
Umweltlernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE, Education for Sustainable Development, ESD) sollen bei den Schüler*innen Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt entwickeln und ihr Wissen über die komplexe und wechselseitige Abhängigkeit zwischen Mensch und Umwelt erweitern (vgl. LPPLUS 2014). Wie Schülerinnen und Schüler sich Wissen über Umwelt, deren komplexe Ursachen sowie Auswirkungen aneignen können und sich mit Normen und Werten auseinandersetzen, um ihre Umwelt zukunftsfähig mitgestalten und schützen zu können, soll im Seminar beleuchtet werden.
- Trainer/in: Christian Gößinger
- Trainer/in: Simon Lermer
- Trainer/in: Franziska Wagner
YouTube ist nur eine von vielen Plattformen einer neuen Medienkultur, die die Distribution und den Zugang zu audiovisuellen Inhalten radikal verändert hat. Die Hoffnung, einen Film oder eine Fernsehserie wiederzusehen, war früher einzig abhängig von der Willkür eines Senders. Heute ist die Erfüllung dieses Wunsches nur einen Click entfernt, der Nimbus einer seltenen Erfahrung verliert sich jedoch in dem Gleichmut, die eine Kultur der ständigen Verfügbarkeit auslöst. Dieses Seminar erforscht die unterschiedlichen Plattformen, Online-Archive, Mediatheken und ihre Effekte nicht nur auf die Wahrnehmung audiovisueller Inhalte, sondern auch auf die Medienwissenschaft selbst, die ihr einst flüchtiges Untersuchungsmaterial jetzt in der aufbereiteten, handlichen Form kurzer Clips geboten bekommt: Theorien und Konzepte werden, so ist anzunehmen, heute auf einer völlig anderen Grundlage entwickelt, ebenso kann die medienwissenschaftliche Lehre auf eine große Auswahl von Clips zurückgreifen. Das Seminar will auch die Auswirkungen auf die Ästhetik neuer audiovisueller Inhalte untersuchen, beispielsweise die Veränderung der Erzählform von Filmen, die sich aus dem über Videoplattformen erworbenen Wissen über audiovisuelle Inhalte ergeben. Ebenso beschäftigt es sich mit den Inhalten selbst, die für Plattformen gestaltet oder bearbeitet werden, beispielsweise Musikclips, Videoclips oder Formen der Selbstpräsentation und der Alltagsinszenierung auf der Plattform YouTube. Es untersucht nicht nur die von Videoplattformen ermöglichte Kreativität der Nutzer, sondern auch die Formatierung dieser Kreativität durch die technologischen Implikationen digitaler Medien.
- Trainer/in: Herbert Schwaab
Während der wöchentlichen Seminarzeit (Mo 10:15-11:45) ist die virtuelle Anwesenheit aller Teilnehmer*innen im Netz erforderlich (Zoom, Link folgt in der Woche vor Seminarbeginn per Mail).
Die Seminaraufgabe besteht in einer wöchentlichen Forschung zu Memes, die in Gruppen durchgeführt wird. Als abschließende Prüfungsleistung ist bis 30.9.2020 eine Hausarbeit zu schreiben (BA: 25.000, MA: 40.000 Zeichen). Die Themenabsprachen erfolgen im Laufe des Semesters.
Die massenhafte Verbreitung von (Miss-)Information über Kommunikationsnetzwerke ist derzeit ein Phänomen, das die weltweite Pandemie Sars-Cov-2 (Covid-19 oder "Corona"-Virus) begleitet. Ein biologisches Virus trifft hierbei auf die Viralität, die moderne Mediennetzwerke erheblich prägt. Die Rolle der "viral propagation – the repeated transmission of a message or idea via peer-to-peer dissemination" (Yeo 2013: 273) - lässt sich dabei für eine Vielzahl von Massenmedien untersuchen. Aber auch die Natur von Viren selbst – biologische als Thema von Massenmedien und elektronische als 'Umformung' massenmedialer Informationsübermittlung - reicht medienhistorisch bis weit vor den Beginn der Netzwerkgeschichte zurück, wird vor allem in dieser aber zu einem zentralen Begriff. Ausgehend von diesen drei Bausteinen – Viren als Thema, Viren als Form medialer Verbreitung und Viren als 'Hemmnis' von Informationsfluss – soll im Seminar eine Mediengeschichte der Viralität in den und durch die Netzmedien nachgezeichnet werden. Ziel ist es zum Ende des Seminars die aktuelle Informationslage zum Corona-Virus, die die WHO auch als #Infodemic bezeichnet hat, medienhistorisch einordnen und analysieren zu können.
Yeo, T. E. Dominic (2013): Viral Propagation of Consumer- or Marketer-generated Messages. In: Belk, Russel W. und Rosa Llamas (Hrsg.): The Routledge Guide to Digital Consumption. Abingdon: Routledge. S. 273-284.
- Trainer/in: Laura Niebling
An Facebooks Metaverse ist nichts neu: nicht sein Begriff, nicht seine Technologie und vor allem nicht sein Konzept. Vielmehr ist die Zukunft, auf die der inzwischen ‚Meta‘ genannte Konzern hinarbeiten will, schon viele Male diskutiert, getestet und verworfen worden. Wie kommt es also zum jüngsten Hype? Und was steckt hinter der langen Begeisterung für die Idee von virtuellen Welten? Unter einem Metaversum versteht man verknüpfte, digitale Raumkonzepte, die auf dem Internet basieren und in der Regel über Virtual-Reality-Technologie zugänglich sind. Vorläufer dieser Form fiktiver Welten sind Games wie das MMORPG ‚Habitat‘ (1985) und Onlineplattformen wie ‚Second Life‘ (2003), zugleich fundiert das Verständnis virtueller Räume wesentlich auf Filmen wie ‚Matrix‘ (1999) oder ‚Ready Player One‘ (2018), die zudem auch in Bezug auf die Visual Effects prägten, welche Vorstellungen von virtuellen Welten entstehen sollten. Aber VR- und AR-Konzepte reichen heute längst bis in die postdigitale Arbeitswelt hinein – der Gesamtkomplex virtueller Welten macht damit ein breites Feld von Unterhaltungsmedien bis Arbeitsmedien in vielen Formen und Formaten auf. Das Seminar soll erste medientheoretische Grundlagen vermitteln, um virtuelle Welten zu analysieren und zu diskutieren. Verschieden Konzepte virtueller Welten werden vorgestellt, Begriffe wie Virtualität und Immersion, aber auch aktuelle technokulturelle Phänomene wie NFTs und Blockchains besprochen und zeithistorisch eingeordnet.
- Trainer/in: Laura Niebling
Virtueller Ersatz für das Schwarze Brett!
Ich werde über das Nachrichten-Modul dieses "Kurses" mit allen (eingetragenen) Pharmazie-Studenten kommunizieren!
(--> Die Nachrichten werden dann an die universitäre eMail-Adresse weitergeleitet!)
Ich empfehle allen Pharmazie-Studenten des Hauptstudiums, sich hier einzutragen (und die Uni-eMail-Adresse regelmäßig zu prüfen)!
Viele Grüße
Christoph Dorn
- Trainer/in: Christoph Dorn
Mit Begriffen wie „Pictorial Turn“ oder „Iconic Turn“ wird seit den 1990er-Jahren eine Fokusverschiebung zu visuellen Medien umschrieben, die nicht nur eine redensartlichen „Bilderflut“ in Folge der Entwicklung neuer Medien, etwa Internet oder Fernsehen, umschreibt, sondern vor allem einen sich verändernden Umgang mit Bildern. Die daraus resultierende, sog. Visual Culture ist vor diesem Hintergrund ein bedeutsamer Forschungsbereich der Medienwissenschaft und bildet zudem eigenständige Schnittstellen zu vielen gegenstandsverwandten Fachdisziplinen, die sich ebenfalls mit Bildern beschäftigen. Dieser große Komplex der Bildforschung lässt sich am besten über einzelne Themen erarbeiten – beispielsweise an der in vielen Ländern der Welt gerade ubiquitär vorhandenen, aber häufig im Alltag kaum beachteten Bildgattung der Warnschilder. Das Seminar führt in die Visual Culture sowie die Visual Studies (in und entlang der Medienwissenschaft) ein und fragt, unter welchen Bedingungen sich eine Visual Emergency Culture medientheoretisch ausbildet und wie sich diese beforschen lässt.
- Trainer/in: Laura Niebling
Kursbeschreibung Vorlesung: „Was ist der Mensch“? – Literatur und Anthropologie. Do 10-12 Uhr (Prof. Dr. Jürgen Daiber)
Die Vorlesung beginnt am 23.04;
Jeden Donnerstag (09:00 Uhr) werden die Folien zur jeweiligen Sitzung hochgeladen. Diese Folien sind mit einem erläuternden Kommentar versehen, der die Inhalte kurz zusammenfasst. Falls Fragen zu den Sitzungen/zu den Folien auftauchen sollten, können Sie sich per Email an Herr Prof. Dr. Daiber wenden (im Notfall ist auch eine Kontaktaufnahme in den Telefonsprechstunden am Mittwoch, 13-14 Uhr möglich). Die Fragen und Antworten werden in einem Dokument (anonym) gesammelt und auf GRIPS für alle zur Verfügung gestellt.
- Dozent: Jürgen Daiber
- Dozent: Eva Reitberger
Die Einführungsvorlesung richtet sich v.a. an Studierende, die erste
Einblicke in die Epoche des Mittelalters erlangen möchten. Ziel der
Veranstaltung ist es, ‚große‘ erzählende Überblicke über politik-,
religions-, wirtschafts- und kulturgeschichtliche Zusammenhänge zwischen
Spätantike und Hochmittelalter mit vertiefenden Detailanalysen,
Forschungs- und Quellenfragen zu kombinieren. Sei es der Gang nach
Canossa (11. Jh.), die Übersetzung des Korans ins Lateinische von Petrus
Venerabilis (12.Jh), die Gründung der Universität Paris (12. Jh), der
Ausbruch der Pest oder der Erlass der Goldene Bulle durch Kaiser Karl IV
(14.Jh): In den einzelnen Vorlesungssitzungen sollen einerseits
„prominente“, manchmal aber auch auf den ersten Blick eher unbekannte
und vermeintlich periphere Ereignisse herausgegriffen und vorgestellt
werden, von denen langfristige Wirkungen ausgingen bzw. von denen
ausgehend sich Zusammenhänge mittelalterlicher Geschichte besonders gut
erklären lassen.
- Trainer/in: Sonja Neumeier
- Trainer/in: Jenny Oesterle
- Trainer/in: Frieda Walter
- Trainer/in: Sonja Neumeier
- Trainer/in: Jenny Oesterle
- Trainer/in: Frieda Walter
Im 18. Jahrhundert begann Russlands europäisches Zeitalter. Zaren wie Peter I. und Katharina II. verstanden die Annäherung an Westeuropa als Fortschritt. Mit der Öffnung nach Europa drangen auch aufklärerische Ideen wie der Lobpreis der Vernunft, Freiheit, Vorstellungen von der Erkennbarkeit der Natur und der Zweifel an überkommenen Gewissheiten in das Zarenreich ein. Statt jedoch die russische Aufklärung als bloße Übernahme einer intellektuellen Strömung nordwesteuropäischer Provenienz anzusehen, ist es sinnvoller von einem Kommunikationsprozess zu sprechen, zu dem wechselseitiges Lernen sowie Missverständnisse gleichermaßen gehören. Die Vorlesung nimmt Russland im Zeitalter der Aufklärung daher von zwei Seiten in den Blick. Zum einen stellt sie dar, wie das Zarenreich in den Augen europäischer Aufklärer zum zivilisatorischen Projekt werden konnte. Zum anderen versteht sie die Aufklärung in Russland auch als russischen Selektionsprozess, in denen aufklärerische Ideen auf fruchtbaren Boden fallen konnten, andere geflissentlich ignoriert wurden. Sie fragt, von welchen Bevölkerungsgruppen die Aufklärung getragen wurde und ob die Obrigkeit eher als Schrittmacher oder als Hemmschuh zu gelten hat. In einem dritten Schritt soll gefragt werden, ob die Aufklärung zur „Europäisierung“ Russlands beigetragen hat, beziehungsweise inwieweit sie dort an ihre Grenzen stieß.
Literatur: Renner, Andreas, Russland: Die Autokratie der Aufklärung, in: Alexander Kraus/Andreas Renner (Hg.), Orte eigener Vernunft. Europäische Aufklärung jenseits der Zentren, Frankfurt, New York 2008, S. 125–142; Schippan, Michael, Die Aufklärung in Russland im 18. Jahrhundert, Wiesbaden, 2012.
- Trainer/in: Julia Herzberg
Vor 150 Jahren, am 20. Oktober 1874, wurde Charles Edward Ives in
Danbury, Connecticut, geboren. Heute gilt er zwar nicht mehr als Vater
der amerikanischen Musik, aber sicherlich als jemand, der dem
Komponieren um 1900 im Anschluss an europäische Vorbilder eine
eigenständig-eigenwillige, modernistische Note verliehen hat. In
direkter Zeitgenossenschaft Arnold Schönbergs entwickelte der als
Versicherungsunternehmer im Hauptberuf tätige Ives eine eigene Vision
von Musik, die konzeptionell, satztechnisch und ideell weit über
tradierte Formen hinausführte. Dabei ist seine Musik kaum unter einfache
und gewohnte Begriffe von Kunstmusik zu bringen; eher entzieht sie sich
der auch in der Musikwissenschaft lange Zeit üblichen Kategorisierung.
Die Vorlesung möchte den ungewöhnlichen Lebens- und Schaffensweg des
Komponisten nachzeichnen, ihn in Bezug zu seinem kulturellen Umfeld in
den USA setzen, experimentelle und traditionelle Elemente identifizieren
und dabei die Bedeutung für die Musik des 20. und 21. Jahrhundert
freilegen.
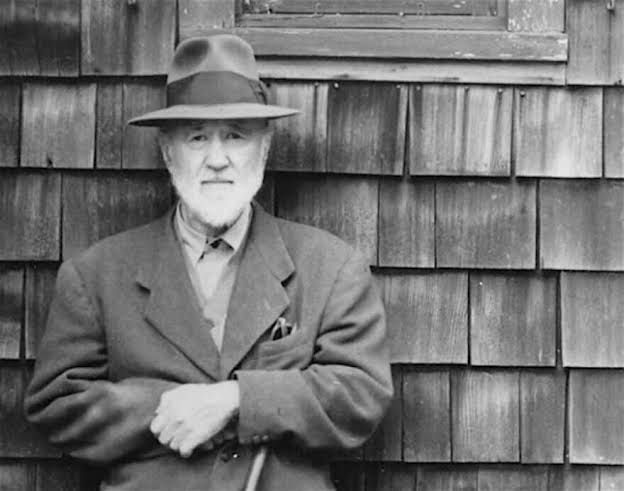
- Trainer/in: Gregor Herzfeld
- Trainer/in: Magdalena Daller
Englisch: Early Christianity and the Religious World of Antiquity
Umfang: 2 SWS
Lehrperson: Prof. Dr. Andreas Merkt
Zeit: Do 16-18 Uhr (c.t.)
Raum: ZH 2
In dieser Vorlesung wird die Herausbildung des kirchlichen Christentums als einer neuen Religion im weltanschaulichen Kosmos der Antike nachgezeichnet. Es wird gezeigt, wie sich seine Identität im Verhältnis zum vorchristlichen sowie zum gleichzeitig sich konturie-renden rabbinischen Judentum, zur Gnosis und zu den polytheistischen Kulten herauskris-tallisiert hat. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Aufkommen des Islam und seiner Beziehung zum spätantiken Christentum.
- Trainer/in: Marko Jovanovic
Filmgeschichte wurde zunächst eher unspezifisch als die chronologische Erfassung internationaler Filmproduktionen begriffen, bevor sich ein Bewusstsein für Methoden und Probleme dieses Ansatzes ergab: Nicht nur die Frage, welche Filme letztlich filmgeschichtlich relevant erscheinen und warum, wurde deutlich, sondern auch die Möglichkeit, Filmgeschichte unter spezifischen Perspektiven zu betrachten, trat in den Fokus. Aus einer kanonischen Geschichte von Filmklassikern entwickelte sich ein vielschichtiger Diskurs über Kontexte der internationalen Filmgeschichte mit jeweils spezifischer Methodik und Theorie.
Der Zoom-Link für die Montags von 10-12 Uhr stattfindenden Sitzungen:
https://uni-regensburg.zoom-x.de/j/65135665283
Die Film-Geschichte wird global oft in die Phasen der Vorgeschichte des Kinos („pré-cinéma“), des Stumm- und des Tonfilms eingeteilt. Die Produktion und Verbreitung von Film stand fast von Beginn an unter ökonomischen Vorzeichen. Die Filmvorführung war zunächst eingebettet in Programmangebote der Unterhaltungsindustrie wie das Variété, die Shows der Music Halls oder des Vaudeville Theatres. Erst nach einigen Jahren bildete sich die Kinoveranstaltung als eigenständiges Unterhaltungsangebot heraus. Mit der Herausbildung des Langfilms um 1913 entstand die Struktur der Kinovorführung, die bis heute vorherrschend blieb – das Zentrum der Veranstaltung bildet der Hauptfilm. Schnell war klar, dass neben dem Stoff der Star der wichtigste Mediator zum Publikum sein würde – seit 1915 bildet sich zunächst in Hollywood, dann schnell in allen anderen Filmindustrienationen das sogenannte Starsystem heraus. Eine Begleitpresse um Stars, Sternchen und Filme entsteht. Der Film wurde schnell zum führenden Produkt der Kulturindustrie.
Die Vorlesung wird sich auf die Epochen des (west)deutschen Kinos beziehen:
1. Frühzeit
2. Expressionismus
3. Neue Sachlichkeit
4. Filme der Naziära
5. Nachkriegszeit
6. Das Ganrekino der 1960er Jahre
7. Neuer deutscher Film
8. Kommerzielle Blüte der 1980er Jahre, Filmförderung
9. Postmodernes deutsches Kino
10. Aktuelles deutsches Kino
Anbei noch die Literatur, auf die ich mich beziehe:
- David Bordwell, Kristin Thompson: Film Art. An Introduction. 10. Auflage. McGraw-Hill, New York 2013
- David Bordwell, Kristin Thompson: Film History. An Introduction. 3. Auflage. McGraw-Hill, New York 2010
- Wolfgang Jacobsen, Anton Kaes, Hans H. Prinzler (Hrsg.): Geschichte des deutschen Films. 2. erw. Auflage. Metzler, Stuttgart 2004
- Geoffrey Nowell-Smith (Hrsg.): Geschichte des internationalen Films. Metzler, Stuttgart 1998
- Trainer/in: Christoph Härtl
- Trainer/in: Marcus Stiglegger
Vorlesung 35503
Franz Kafkas Welt
„Kafka lehrt Bescheidenheit. Wer sich an ihm versucht, muss damit rechnen, zu versagen.“ (R. Stach). Die Anzahl an Sekundärliteratur zu Kafkas Texten hat mittlerweile bei einigen seiner Erzählungen und Romane den fünfstelligen Bereich erreicht (Bsp.: Der Prozess). Jede literaturtheoretische „Schule“ hat Interpretationsangebote zum Werk in allen denkbaren Spielarten und Mischformen gemacht. Selbst das schlichte Unterfangen, ein paar grundlegende biographische Informationen mit dem Suchbegriff „Kafka“ über Google einzuholen, bringt 18, 6 Millionen Fundstellen (Stand: 16.01.2024). Dies alles angesichts eines Werks, welches lediglich vierzig vollendete Prosatexte aufweist, die in der heute maßgeblichen Kritischen Kafka Ausgabe etwa 350 Druckseiten ausmachen. Daneben hat Franz Kafka etwa 3400 Druckseiten (Tagebuchaufzeichnungen, literarische Fragmente) hinterlassen, darunter drei Romane. Etwa 1500 Briefe, die von Kafka erhalten blieben und nahezu vollzählig publiziert sind, kommen hinzu. Die Vorlesung will angesichts dieser Überfülle einen Einstieg in Literatur, Leben und aktuellen Forschungsstand zu Franz Kafka bieten.
Als begleitende Lektüre zur Vorlesung sei empfohlen: Reiner Stach: Kafka – Die frühen Jahre/Die Jahre der Entscheidungen/Die Jahre der Erkenntnis.
- Trainer/in: Felicitas Andel
- Trainer/in: Jürgen Daiber
Mi 12-14 Uhr
H 9
Als Reaktion auf den Livländischen Krieg, das Terrorregime unter Ivan IV. und die große Wüstungsperiode schränkte das Moskauer Reich Ende des 16. Jahrhunderts das Recht der Bauern auf freien Abzug erstmalig ein. Das Gesetzbuch von 1649 band die Bauern dann lebenslänglich an den Grundherrn. Damit hatte sich die ursprünglich als Notmaßnahme gedachte Aufhebung der Freizügigkeit zu einer generellen Bindung an die Scholle verfestigt.
Die Vorlesung beleuchtet zunächst die Motive des Staates, der mit der Einführung der Leibeigenschaft die Militärdienstfähigkeit des Adels und ein verlässliches Steueraufkommen sicherstellen wollte. In einem zweiten Schritt wird untersucht, wie die Bauern auf die Einführung der Leibeigenschaft reagierten. Wir schauen insbesondere auf das Läuflingswesen und die Aufstände, die das Moskauer Reich im 17. Jahrhundert erschütterten. In einem dritten Schritt betrachten wir die gemeinsamen Lebenswelten der Leibeigenen und Gutsadligen. Hierfür nehmen wir eine vergleichende Perspektive ein und fragen, inwieweit sich die Leibeigenschaft in Russland von anderen Formen unfreier Arbeit, z.B. der Leibeigenschaft in anderen europäischen Ländern sowie der Sklaverei in den USA unterschied. Abschließend untersuchen wir, aus welchen Gründen die Leibeigenschaft im 18. Jahrhundert zunehmend in die Kritik geriet und warum es trotzdem erst 1861 zur Bauernbefreiung kam.
Literatur:
Peter Kolchin, UnfreeL. American Slavery and Russian Serfdom, Cambridge, Mass. 1987; David Moon, The Abolition of Serfdom in Russia, 1762 - 1907 (= Seminar Studies in History), Harlow 2001; Christoph Schmidt, Sozialkontrolle in Moskau. Justiz, Kriminalität und Leibeigenschaft 1649 - 1785. Zugl.: Köln, Univ., Habil.-Schr., 1993-94 (= Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa, Bd. 44), Stuttgart 1996; Elise Kimerling Wirtschafter, Russia's Age of Serfdom 1649 - 1861 (= The Blackwell history of Russia), Malden, Mass. u.a. 2008.
Leistungsnachweis: Klausur
- Trainer/in: Julia Herzberg
- Trainer/in: Agnes Rugel
Die Flüchtigkeit von Musik und die Tatsache, dass sich der eine Moment, in dem ein Stück erklingt, nicht wiederholen lässt, hat durch die Musikgeschichte hindurch immer wieder zu Versuchen geführt, Musik zu speichern und wiederholbar zu machen.
Schon Notation kann Grundlage für eine Wiederaufführung sein und Musikautomaten führten die Wiederholung von Musik in unterschiedlicher Qualität über mehrere Jahrhunderte vor. Doch um 1900 kam eine Palette an Instrumenten und Medien hinzu, die die Musik und das Musikhören der Zeit in besonderem Maße prägten:
Player Pianos gaben zuvor eingespielte Interpretationen wieder, mit dem Grammophon kamen die ersten Gesangsstars ins heimische Wohnzimmer, der Phonograph fand Verwendung in der Aufzeichnung von Dialekten, Sprachen und Volksliedern verschiedener Ethnien, so dass er nicht zuletzt zum Instrument der Musikethnologie wurde. Frühe elektronische Instrumente wie das Trautonium spielten direkt ins Radio, Tonbänder steuerten Geräte und eigneten sich als Tonspuren für den Film. Für diese Instrumente und Medien wurde aber auch in einer Weise komponiert, die auf ihre Eigenarten zugeschnitten war. Der Einfluss früher Medien auf Musik und Musikwissenschaft ist das Thema dieser Vorlesung.
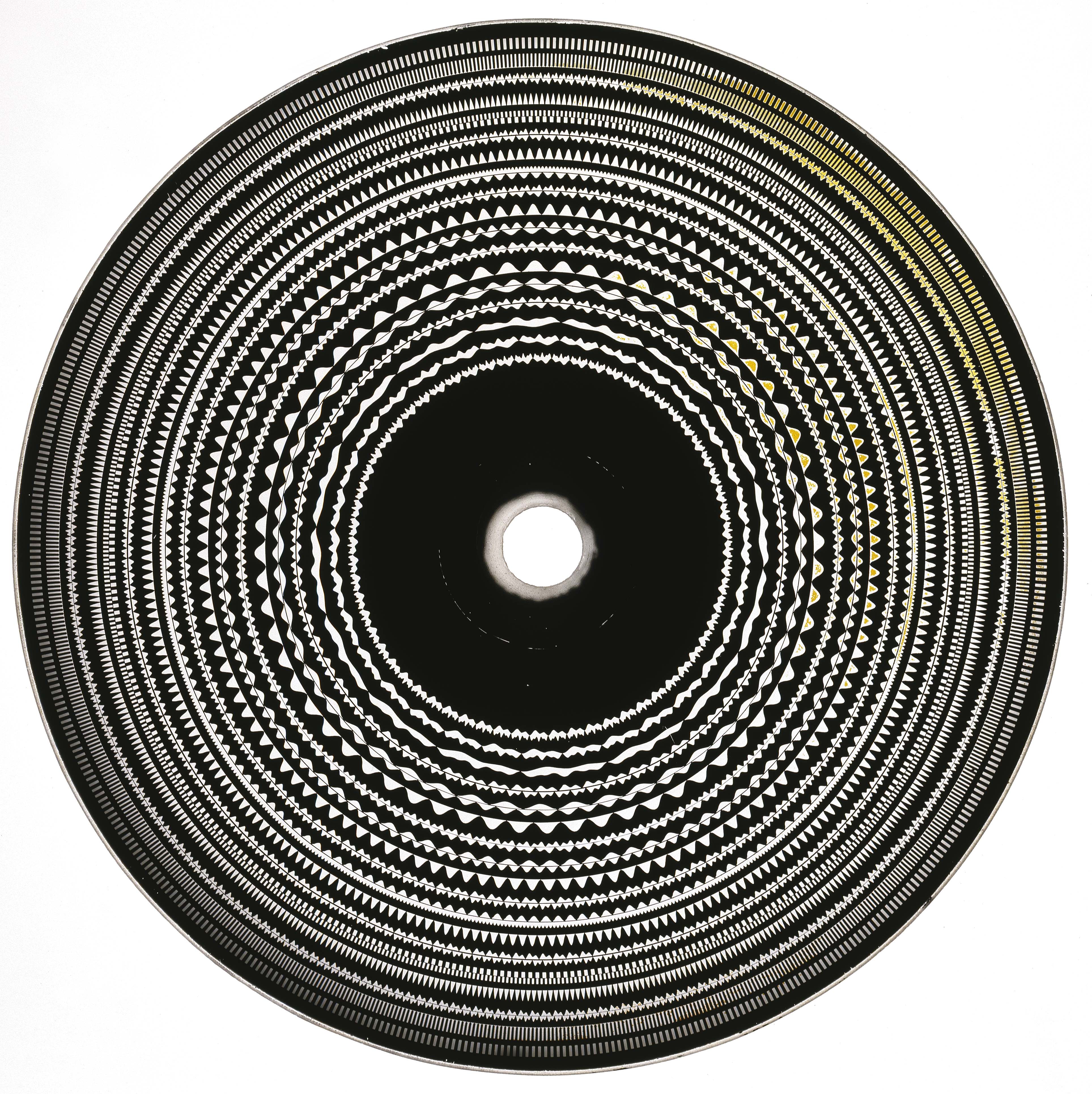
- Trainer/in: Rebecca Wolf
Frühe Moderne im literaturwissenschaftlichen Sinne setzt zeitlich nicht mit der Querelle des Anciens et des Modernes (1687) ein, sondern markiert stattdessen die Schwelle hin zum 20. Jahrhundert, exakter: einen Zeitraum, der etwa von 1890-1930 reicht. Dieser Zeitraum der literarischen Moderne schlägt sich wesentlich in der Erschütterung traditioneller Weltbilder nieder. Gemeint sind neue, das Denken revolutionierende Wissensbestände (Quantentheorie, Relativitätstheorie, Psychoanalyse); weiterhin das Aufkommen neuer Erzähltechniken (innerer Monolog, stream of consciousness) und zeitgleich auftretende, dabei divergierende literarische Strömungen (Symbolismus, Expressionismus, Neue Sachlichkeit etc.). Die Vorlesung hat das Ziel, a) wichtige kultur-, natur- und sozialwissenschaftliche Wissensbestände dieser Phase zu dokumentieren und b) literarische Schlüsseltexte der Epoche (Bsp: Kafka: Der Prozess, A. Döblin: Berlin Alexanderplatz, R.M. Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, T. Mann: Der Zauberberg, C. Einstein: Bebuquin etc.) einer eingehenden Analyse zu unterziehen
- Trainer/in: Felicitas Andel
- Trainer/in: Jürgen Daiber
Im 18. Jahrhundert begann Russlands europäisches Zeitalter. Zaren wie Peter I. und Katharina II. verstanden die Annäherung an Westeuropa als Fortschritt. Mit der Öffnung nach Europa drangen auch aufklärerische Ideen wie der Lobpreis der Vernunft, Freiheit, Vorstellungen von der Erkennbarkeit der Natur und der Zweifel an überkommenen Gewissheiten in das Zarenreich ein. Die Vorlesung nimmt daher als erstes die Bedeutung der Aufklärung für das Petersburger Imperium in den Blick. Zum einen stellt sie dar, wie das Zarenreich in den Augen europäischer Aufklärer zum zivilisatorischen Projekt werden konnte. Zum anderen versteht sie die Aufklärung in Russland auch als russischen Selektionsprozess, in denen aufklärerische Ideen auf fruchtbaren Boden fallen konnten, andere geflissentlich ignoriert wurden. Gefragt werden soll, ob die Aufklärung zur „Europäisierung“ Russlands beigetragen hat, beziehungsweise inwieweit sie dort an ihre Grenzen stieß.
In einem zweiten Schritt wird das Verhältnis Russlands zu Europa und Asien im 18. Jahrhundert anhand der russischen Außenpolitik thematisiert. Während Peters I. Unternehmungen gegen das Osmanische Reich keine bleibenden Erfolge brachten, gelang es unter seiner Herrschaft, Russland als Vormacht in Osteuropa und im Ostseeraum zu etablieren. Katharina trat schließlich in die Fußstapfen Peters I. Ein Krieg gegen das Osmanische Reich brachte die Steppengebiete nördlich des Schwarzen Meeres sowie die Krim unter russische Herrschaft, während durch die mit Preußen und Österreich vereinbarten Teilungen Polens der Ostteil der Adelsrepublik in das Zarenreich eingegliedert werden konnten .
Die territoriale Expansion musste innenpolitisch abgestützt werden. Die Vorlesung beleuchtet in einem dritten Schritt die insbesondere von Peter I. und Katharina II. eingeführten Neuerungen in der Militär- und Finanzorganisation, im Recht, Zivilverwaltung, Wirtschaft, Sozialstruktur, Kirche und Bildung. Deutlich zeigt sich, dass alle Bevölkerungsgruppen immer stärker in die Dienste des Staates gestellt wurden, was unter Katharina II. trotz ihrer aller Bekenntnisse zur Aufklärung zu einer Verfestigung der Leibeigenschaft führte.
Literatur:
Renner, Andreas, Russland: Die Autokratie der Aufklärung, in: Alexander Kraus/Andreas Renner (Hg.), Orte eigener Vernunft. Europäische Aufklärung jenseits der Zentren, Frankfurt, New York 2008, S. 125–142; Hughes, Lindsey, Russia in the age of Peter the Great, New Haven, London, 2000; Kamenskii, Aleksandr, The Russian empire in the eighteenth century: Searching for a place in the world, Armonk, N.Y, 1997; Raeff, Marc, Imperial Russia 1682-1825: The Coming of Age of Modern Russia, New York, 1971.
- Trainer/in: Julia Herzberg
Die Vorlesung handelt allgemein von den Kontaktzonen, die aufgrund der spanischen Überseeeexpansion vor allem in Amerika und Asien entstanden sind. Hierbei geht es sowohl um sozio-kulturelle als auch um sprachliche Auswirkungen dieses Kontakts. Neben dem allgemeinen Thema der interkulturellen Kommunikation vor Ort werden auch die Rollen von Indigenen, Händlern, Kolonisten, Missionaren und Seeleuten während des Aufbaus des ersten globalisierenden Reiches beleuchtet. Dabei findet auch die linguistische Tätigkeit der Missionare Berücksichtigung, die in einem unermüdlichen Eifer zuvor weder verschriftlichte noch beschriebene indigene Sprachen dokumentierten. Ausgehend davon sind aufgrund der zahlreichen metasprachlichen Kommentare auch Rückschlüsse auf die spanische Phonologie bzw. Morphosyntax möglich.
In general, the lecture is concerned with the contact zones which emerged due to the Spanish overseas expansion, especially in the Americas and Asia. In this context, we will have a look at socio-cultural as well as linguistic consequences of these contact scenarios. Apart from the general topic of intercultural communication in situ we will also focus on the different roles played by the indigenous population, merchants, colonizers, missionaries and sailors during the establishment of the first globalizing empire. At the same time, the linguistic endeavor of the missionaries, who – in their indefatigable diligence - documented hitherto unwritten and undescribed indigenous languages, will also be taken into consideration. Not least, the numerous metalinguistic commentaries regarding the Spanish language and dialectology of the time shed light on Spanish phonology and morphosyntax.
- Trainer/in: Hans-Jörg Döhla
Herzlich Wilkommen im GRIPS-Kursraum der Vorlesung: Kommunismus und Postkommunismus im Sommersemester 2014. Hier werden Folien und Hinweise der Veranstaltung online gestellt, die prüfungsrelevant sein werden.
Die Analyse des kommunistischen Totalitarismus wird zum Anlass genommen, nach den Gründen für Entstehung demokratischer und autoritärer Systeme in Mittel- und Osteuropa zu fragen. Darüber hinaus werden die spezifischen Eigenschaften der neuen postkommunistischen Systeme analysiert.
- Trainer/in: Manuel Steudle
Das östliche Europa ist häufig als ein Laboratorium der Moderne beschrieben worden, wo sich autoritär modernisierende Aufholjagden und konservative Beharrung wechselseitig beding(t)en. Doch während die „progressiven“ Strömungen in der Region meistens wie westliche Importe wirkten, präsentieren sich die konservativen Reaktionen darauf als „authentische Stimme“, die oft auch noch einen Anspruch darauf erheben, der europäischen Zivilisation als solcher einen Weg aus ihrer vermeintlichen Krise zu weisen. Den Ausgangspunkt dieser Vorlesung bildet die heutige gesellschaftliche Polarisierung und die dynamische Blüte der europäischen Rechten, welche ohne historische Kenntnisse über die Geschichte des konservativen Denkens nicht zu verstehen ist. Die Vorlesung beschäftigt sich mit der Ideengeschichte Russlands, Ostmittel- und Südosteuropas seit dem 19. Jahrhundert, wobei auch die transregionalen Verflechtungen bis nach Westeuropa und die USA nicht zu kurz kommen.
Leistungsnachweis: Klausur
Literatur: Bluhm, Katharina et al. (Hgg.) (Hg.) (2019): New conservatives in Russia and East Central Europe. London: Routledge.
- Trainer/in: Klaus Buchenau
Die europäische Romantik ist von einem regen kulturellen Transfer ihrer Konzepte geprägt. Dies soll in der Vorlesung vor allem anhand der slavischen Literaturen, konkret der russischen, tschechischen und polnischen nachgezeichnet werden. In der Entwicklung ihrer je eigenen Konzepte von Romantik nehmen diese Kulturen auf andere, bereits kursierende Konzepte Bezug und adaptieren sie der eigenen kulturellen Situation. So sind das in der deutschen Frühromantik entwickelte, philosophieaffine Konzept der Universalpoesie und die damit verbundene Aufwertung der Literatur gegenüber der Philosophie, aber auch die Identitätsphilosophie Schellings für den Literaturzentrismus der russischen Kultur äußerst attraktiv. Es kommt im Kreis der Moskauer „Weisheitsfreunde“ um Vladimir Odoevskij zu einem „Schellingianismus“, den Odoevskij später in seinem Erzählzyklus Russkie noči (Russische Nächte) literarisch gestaltet. Vielfältige Anregungen bezog er dabei auch von E.T.A. Hoffmann. Zu einem wandernden Konzept wird auch der Byronismus, jene Form von Poemen, die um einen charakteristischen, von der Gesellschaft in Weltschmerz enthobenen Helden kreisen und die exemplarisch zunächst bei Byron gestaltet und dann vielfach unter dem Schlagwort des byronistischen Helden rezipiert wurde. Eine Auseinandersetzung mit diesem Typus sind Aleksandr Puškins Südliche Poeme sowie sein Evgenij Onegin. Auch der tschechische Romantiker Karel Hynek Mácha knüpft mit seiner Gestaltung eines zerrissenen Helden in Máj (Der Mai) hier an. Für die tschechische Romantik, die sich vor allem im Zeichen der nationalen Wiedergeburt vollzieht, ist die idealisierende Hinwendung zum ,einfachenVolk‘, die sich ebenfalls in vielen Kulturen der Zeit beobachten lässt, von besonderem Gewicht – exemplarisch in Karel Jaromír Erbens Balladensammlung Kytice (Der Blumenstrauß). Was in der deutschen (Früh-)Romantik als „Neue Mythologie“ konzipiert wird, als Forderung an die Literatur, gemeinschaftsstiftende Werke zu schaffen, wird mit einem Werk wie Jan Kollárs Slávy dcera (Der Sláva Tochter) gewissermaßen umgesetzt: ein mehrere Gesänge umfassender Sonettzyklus, der einen slavischen Mythos gleichermaßen schafft und inszeniert. Auch die Fälschung mittelalterlicher Handschriften (Grünberger und Königinhofer Handschrift) lässt sich in diesem Kontext lesen. Für die polnische Romantik wird vor dem politischen Hintergrund der Teilungen des Staates zwischen fremden Mächten insbesondere das von Mickiewicz vertretene Konzept des polnischen Messianismus prägend.
- Trainer/in: Irina Wutsdorff
- Trainer/in: Kordula Beck
- Trainer/in: Birgit Bergmann
- Trainer/in: Maximilian David
- Trainer/in: Katrin Dorfner
- Trainer/in: Natalia Meling