Jeder Teilnehmer an der Klausureinsicht bekommt eine Einsichtszeit von
30 Minuten. Die Einsicht kann prinzipiell von 10.05 bis 11.45 Uhr
stattfinden. Nach Ablauf der Anmeldefrist finden Sie ab 08.11.23
(nachmittgs) die Einteilung hier im Anmeldebereich. Auf private
Terminwünsche kann leider keine Rücksicht genommen werden. Die Einsicht
findet im Hörsaal der Instru-II-Vorlesung statt. Die Einsicht richtet sich nur an diejenigen
Teilnehmer, die die Klausur vom 1.9.23 nicht bestanden haben. Beachten
Sie, dass zu dem Termin nur eine Einsicht in den Teil Strasser möglich
ist. Prof. Köberle wird einen separaten Einsichtstermin für ihren Teil
anbieten.
GRIPS - Uni Regensburg
Suchergebnisse: 1768
Die europäische Frühe Neuzeit wird oft als Geschichte der Entwicklung von Monarchie und Staatlichkeit erzählt. Doch was passiert eigentlich in diesem Europa der Könige mit einer der mächtigsten Monarchien Europas, die gern als Fixpunkt für das Konzept des Absolutismus genommen wird, wenn der Monarch diese Rolle nicht wahrnehmen will oder kann? Zwischen der Ermordung Heinrichs IV. von Frankreich 1610 und dem Regierungsantritt Ludwigs XIV., des „Sonnenkönigs“, 1661, wird Frankreich überwiegend von Ministern und RegentInnen regiert. Sowohl Ludwig XIII. als auch Ludwig XIV. treten als Kinder die Nachfolge ihrer Väter an, sie wachsen in ihre Ämter hinein. In der Forschung wird dieses Zeitalter häufig über seine mächtigen Minister als „Frankreich unter Mazarin und Richelieu“ charakterisiert. Inwiefern ist diese Charakterisierung zutreffend?
Um diese Frage zu beantworten, wollen wir in diesem Proseminar gemeinsam die politischen Verhältnisse im Frankreich des frühen 17. Jahrhunderts genauer beleuchten. Aus möglichst vielen Blickwinkeln werden wir erforschen, wie Akteure und gesellschaftliche Normen die Wahrnehmung von Monarchie nach innen und außen formten, wie aber auch eine Monarchie ohne Kopf ganz praktisch, etwa bei den Verhandlungen zum Westfälischen Friedenskongress, funktionieren konnte und wo die Monarchie vielleicht nicht ganz so kopflos war, wie gemeinhin angenommen. Dabei führt uns die Thematik mitten in die Epoche der Frühen Neuzeit hinein, und zwar sowohl mit ihren Eigenheiten, aber auch mit dem, was uns bis heute mit ihr verbindet.
Methodisch bietet das Proseminar die Möglichkeit, auf breitem inhaltlichen Fundament das Handwerkszeug wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens zu erlernen. Das Seminar wird komplett digital gehalten.
- Trainer/in: Elisabeth Natour
- Trainer/in: Maximilian Scholler
Die Erstbegegnung europäischer
Seefahrer mit der „Neuen Welt“ führte im Zusammenspiel mit Reformation
und Renaissance zum Ende mittelalterlicher Lebenswelten und markierte
den Übergang zum modernen Europa. In den folgenden drei Jahrhunderten,
jener Epoche, die heute als Frühe Neuzeit bezeichnet wird, entstanden
weite Bereiche der Alltagskultur, die gegenwärtig in der Wende zum
postindustriellen, globalen und digitalen Zeitalter im Verschwinden
begriffen sind. Obwohl sich die Vergleichende Kulturwissenschaft auch
als historische Disziplin versteht, wird diese Epoche, die für das
Verständnis europäischer Kultur grundlegend ist, zumeist stiefmütterlich
behandelt. Dagegen steht die Frühe Neuzeit zunehmend im Zentrum
global-, sozial- und kolonialhistorischer Forschungen.
Die angekündigte Vorlesung wird
sich der Zeit zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert aus der
spezifischen Perspektive der Vergleichenden Kulturwissenschaft annähern
und dabei Ergebnisse der Nachbardisziplinen miteinbeziehen. Dabei liegt
der Fokus auf dem deutschen Sprachraum – da sich unser Fach jedoch als
Europäische Ethnologie versteht, werden die entsprechenden Themenfelder
auch in ihren internationalen Bezügen reflektiert.
Einem allgemeinen Überblick
über die Rahmenbedingungen folgt eine Analyse alltagskultureller Aspekte
unter besonderer Berücksichtigung exemplarischer und interdisziplinär
relevanter Themenfelder. Dazu gehören etwa die komplexe Kommunikation,
Mentalität, Religion, Aberglaube, Hexenverfolgung, Brauch, Handwerk,
Wohnen/Wirtschaften, Medizin, Kleidung, Ernährung,
Protoindustrialisierung und Genderspezifik sowie die Beschäftigung mit
dem Verhältnis zwischen Menschen und Natur.
- Trainer/in: Anna Häckel-König
- Trainer/in: Gunther Hirschfelder
- Trainer/in: Marie Laufkötter
Die Entdeckung Amerikas führte im Zusammenspiel mit Reformation und Renaissance zum Ende mittelalterlicher Lebenswelten und Übergang zum modernen Europa. In den folgenden drei Jahrhunderten, jener Epoche, die heute als Frühe Neuzeit bezeichnet wird, entstanden weite Bereiche der Alltagskultur, die gegenwärtig in der Wende zum postindustriellen, globalen und digitalen Zeitalter im Verschwinden begriffen sind. Aber obgleich sich die Vergleichende Kulturwissenschaft auch als historische Disziplin versteht, wird diese Epoche, die für das Verständnis europäischer Kultur grundlegend ist, eher stiefmütterlich behandelt. Dagegen steht die Frühe Neuzeit zunehmend im Zentrum global-, sozial- und kolonialhistorischer Forschungen.
Die angekündigte Vorlesung wird sich der Zeit zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert aus der spezifischen Perspektive der Vergleichenden Kulturwissenschaft annähern und dabei Ergebnisse der Nachbardisziplinen miteinbeziehen. Der Fokus liegt dabei auf dem deutschen Sprachraum – da sich unser Fach jedoch als Europäische Ethnologie versteht, werden die entsprechenden Themenfelder auch in ihren internationalen Bezügen reflektiert.
Einem allgemeinen Überblick über die Rahmenbedingungen folgt eine Analyse alltagskultureller Aspekte unter besonderer Berücksichtigung exemplarischer und interdisziplinär relevanter Themenfelder. Dazu gehören etwa die Komplexe Kommunikation, Mentalität, Religion, Aberglauben, Hexenverfolgung, Brauch, Handwerk, Wohnen/Wirtschaften, Medizin, Kleidung, Ernährung, Protoindustrialisierung und Genderspezifik sowie die Beschäftigung mit dem Verhältnis zwischen Menschen und Natur.
Die Vorlesung richtet sich an Studierende der Schwerpunktbereiche 11 und 12. Behandelt werden das Tarifrecht und die damit zusammen-
hängenden Materien: das Recht der Koalitionen (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände), das Tarifvertragsrecht mit den aktuellen Bezügen
zum Recht des Mindestlohns und der Mindestarbeitsbedingungen, sowie das Arbeitskampf- und Schlichtungsrecht jeweils unter Einbeziehung
des Rechts der EU sowie der EMRK. Im SS 2023 wird dann im Rahmen der Vorlesung "Kollektives Arbeitsrecht II" das Recht der Unternehmens-
mitbestimmung un der betrieblichen Mitbestimmung behandelt. Beide Teile können auch in umgekehrter Reihenfolge gehört werden; es sollte
aber mit dem ersten Teil begonnen werden.
- Koalitionsrecht: Gewerkschaftsbegriff; gewerkschaftliche Betätigung im Betrieb; Mitgliedschaft in den Koalitionen; Rechtstatsächliches zum
Organistionsgrad und zum Aufbau und zur Struktur der Gewerkschaften; historische Entwicklung
- Tarifvertragsrecht: Zustandekommen, Inhalt, Wirkung und Beendigung von Tarifverträgen; Tarifkonkurrenz und Tarifpluralität; Verhältnis
zu anderen Rechtsquellen
- Arbeitskampfrecht: Streik und EU-Grundfreiheiten; Formen, Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Streiks
- Arbeitsgerichtliches Verfahren: Zuständigkeit, Verfahrensarten und einstweiliger Rechtsschutz
In der ersten Vorlesungsstunde wird ein Skriptum ausgegeben, das die in der Vorlesung gezeigten Schaubilder und Prüfungsschemata
sowie eine Übersicht der empfehlenswerten Literatur enthält.
- Trainer/in: Frank Maschmann
- Trainer/in: Moritz Weinberger
- Trainer/in: Stefan Körkel
- Trainer/in: Philipp Meister
- Trainer/in: Christin Hansen
- Trainer/in: Georg Köglmeier
- Trainer/in: Heinrich Konen
- Trainer/in: Anne Mariss
- Trainer/in: Mark Spoerer
Freiwilliger Kurs für alle Studierenden im 5. klinischen Semester. Kursinhalt Arzt-Patienten-Kommunikation in der Palliativmedizin.
- Trainer/in: Test UserMedizin05
- Trainer/in: Pia Zilcher
- Trainer/in: Philipp Artmann
- Trainer/in: Alexandra Franke-Nanic
- Trainer/in: Christian Gegner
- Trainer/in: Koordination MSCR
- Trainer/in: Katharina Weikl
- Trainer/in: Pia Zilcher
Die Veranstaltung findet in Präsenz in wöchentlichen Terminen zur angegebenen Seminarzeit (Montag, 10-12 c.t.) in Raum VG 0.15 statt
Die organisatorische Abwicklung wird über GRIPS durchgeführt.
Die erste Sitzung findet in am 25.04.22 statt.
Studienleistung: Referat
Prüfungsleistung: Hausarbeit
- Trainer/in: Solveig Ottmann
- Trainer/in: Jennifer Wolter
- Trainer/in: Stefan Seifert
- Trainer/in: Matthias Langgartner
- Trainer/in: Andreas Loscher
- Trainer/in: Petra Möhler
In der Vorlesung Kommutative Algebra werden Ringe, Moduln, noethersche und artinsche Ringe,
Bewertungsringe und die Konzepte der Flachheit, Lokalisierung, Komplettierung und Krull-Dimension
vorgestellt. Weiter werden Grundkonzepte der homologischen Algebra behandelt. Es wird NICHT
erwartet, dass die Hörer bereits die Vorlesung Algebra absolviert haben. Diese Vorlesung bildet
zusammen mit der Vorlesung Algebra die Grundlage für eine weitere Vertiefung im Bereich der
algebraischen Zahlentheorie oder der algebraischen Geometrie.
- Trainer/in: Paul Bärnreuther
- Trainer/in: Denis-Charles Cisinski
- Trainer/in: Adeel Khan
- Trainer/in: Saskia Lindenberg
- Trainer/in: Denis Nardin
- Trainer/in: Raphael Schmidpeter
- Trainer/in: Niko Naumann
- Trainer/in: Johann Haas
- Trainer/in: Daniel Heiß
- Trainer/in: Moritz Kerz
- Trainer/in: Morten Lueders
- Trainer/in: Benjamin Dünzinger
- Trainer/in: Thomas Fenzl
- Trainer/in: Moritz Kerz
- Trainer/in: Yassin Mousa
- Trainer/in: Florian Strunk
In der Vorlesung beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Theorie kommutativer Ringe (noethersche Ringe, Dimension, Hilberts Basissatz und Nullstellensatz), Modultheorie, homologische Algebra. Diese Vorlesung bildet zusammen mit der Vorlesung Algebra die Grundlage für eine weitere Vertiefung im Bereich der algebraischen Zahlentheorie, der algebraischen Geometrie oder der algebraischen Topologie.
- Trainer/in: Marc Hoyois
- Trainer/in: Pavel Sechin
In der Vorlesung werden kommutative Ringe (noethersche Ringe, Dimension, Hilberts Basissatz, ...), Modultheorie sowie Grundkonzepte der homologischen Algebra behandelt. Diese Vorlesung bildet zusammen mit der Vorlesung Algebra die Grundlage für eine weitere Vertiefung im Bereich der algebraischen Zahlentheorie oder der algebraischen Geometrie.
- Trainer/in: Liva Diler
- Trainer/in: Carolyn Echter
- Trainer/in: Max Glaser
- Trainer/in: Christoph Winges
Vorlesung "Kommutative Algebra" im Sommersemster 2017.
- Trainer/in: Daniel Heiß
- Trainer/in: Niko Naumann
In der Vorlesung beschäftigen wir uns mit folgenden
Themen:
Theorie kommutativer Ringe
(noethersche Ringe, Dimension, Hilberts Nullstellensatz, etc.),
Modultheorie, homologische
Algebra.
Diese Vorlesung bildet
zusammen mit der Vorlesung Algebra die Grundlage für eine
weitere Vertiefung im Bereich der
algebraischen Zahlentheorie oder der algebraischen
Geometrie.
- Trainer/in: Thomas Baumgartner
- Trainer/in: Zhelun Chen
- Trainer/in: Jonas Linßen
- Trainer/in: Niko Naumann
- Trainer/in: Daniel Fauser
- Trainer/in: Clara Löh
- Trainer/in: Melanie Bausch
- Trainer/in: Thomas Martinec
Montag, 28. Oktober 2024 von 9.00 bis 15.00 Uhr
Schulungszentrum Further Str. 10a, 1. Stock (Eingang auf der Rückseite)
Wegen des Forschungsfreisemesters von Prof. Maschmann finden im WS 2024-25 regulär keine Vorlesungen statt.
Statt dessen wird einmalig ein eintägiger Kompakt-Kurs angeboten, der die wesentlichen Inhalte der Vorlesung im Kollektiven Arbeitsrecht in verkürzter Form präsentiert.
Es werden unter anderem die folgenden Themen behandelt:
- Koalitionsrecht: Gewerkschaftsbegriff, gewerkschaftliche Betätigung im Betrieb
- Tarifvertragsrecht: Zustandekommen, Inhalt, Wirkung und Beendigung von Tarifverträgen, Geltung von Tarifverträgen, Tarifkonkurrenz und Tarifpluralität, Verhältnis zu anderen Rechtsquellen, Beendigung von Tarifverträgen, Tarifflucht
- Arbeitskampfrecht: Formen, Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Streiks
Literatur:
Zu Beginn des Kompakt-Kurses wird ein Skriptum ausgegeben, das die in der Vorlesung gezeigten Schaubilder und Prüfungsschemata sowie eine Übersicht der empfehlenswerten Literatur enthält.
Bitte die aktuelle Gesetzessammlung „Arbeitsgesetze“, 105. Aufl. 2024 mitbringen.
Hinweis:
Im Sommersemester 2025 wird dann im Rahmen der Vorlesung „Kollektives Arbeitsrecht II“ das Recht der Unternehmensmitbestimmung und der betrieblichen Mitbestimmung behandelt. Beide Teile können auch in umgekehrter Reihenfolge gehört werden; es sollte aber mit dem ersten Teil begonnen werden.
- Trainer/in: Homepage Arbeitsrecht
- Trainer/in: Julius Brunner
- Trainer/in: Frank Maschmann
- Trainer/in: Gisela Schober
- Trainer/in: Moritz Weinberger
- Trainer/in: Sebastian Holzbrecher
- Trainer/in: Jürgen Kittsteiner
- Trainer/in: Manuela Zachmayer
- Trainer/in: Angela Enders
Der Kompetenzbegriff hat in den vergangenen Jahren nicht nur den Bildungsbegriff abgelöst, sondern gewinnt seither auch zusehens an Bedeutung. Damit wird dem Fachwissen im Bildungssystem und am Arbeitsmarkt Konkurrenz gemacht. Gemeint sind Schlüsselqualifikationen, welche neben dem Fachwissen zum Handeln befähigen. Hierzu zählen methodische, soziale, individuelle und mediale Kompetenzen. Die Frage ist nur, wo und wie lernt man diese "Kompetenzen" eigentlich?
Im Rahmen dieses Seminars möchten wir uns mit den Grundlagen dieser verschiedenen Kompetenzen beschäftigen, die Möglichkeiten des Trainings beleuchten und am Ende selbst einige von ihnen trainieren.
- Trainer/in: Julia Haager
Grundlagen der Koordinationschemie - einschließlich Koordinationszahlen, Koordinationsgeometrien, Isomerie, elektronische Struktur, spektroskopische Eigenschaften, Reaktivität
- Trainer/in: Corinna Hess
- Trainer/in: Corinna Hess
- Trainer/in: Florian Schwemin
Der Mythos von König Artus gehört zu den wichtigsten europäischen Herrschermythen und hat (nicht nur) die deutsche Literatur des Mittelalters maßgeblich beeinflusst. Ausgehend von chronikalischen Zeugnissen wird im Kontext der Sprachgrenzen überschreitenden literarischen Verbreitung der Artusfigur die spezifische 'Arbeit am Mythos' beleuchtet, die in den Artusromanen der mhd. 'Klassik' rekonstruiert werden kann. In exemplarischer Auswahl sollen ebenfalls 'nachklassische' Beispiele ergänzend bzw. vergleichend hinzukommen. Da der Mythos von König Artus und den Rittern der Tafelrunde wirkungsgeschichtlich auch die Grenzen des Mittelalters überschritten hat, wird abschließend der Blick auch auf moderne Verarbeitungen (u.a. im Jugend- bzw. Schulbuchbereich) zu werfen und zu fragen sein, ob bzw. inwiefern hier (De-)Formationen eines mythischen Potenzials im Spiel sind. Die Textauswahl kann, abgesehen von den mhd. 'Klassikern' (Hartmanns 'Erec' und 'Iwein' sowie Wolframs 'Parzival'), auch von den am Seminar teilnehmenden Studierenden mitbestimmt werden. Es wird erwartet, dass die genannten 'Klassiker' allen Teilnehmenden zu Beginn des Seminars bekannt sind.
Eine Liste mit Lektürehinweisen ist ab Mitte Juli im Sekretariat abzuholen.
- Trainer/in: Verena Ebermeier
- Trainer/in: Edith Feistner
- Trainer/in: Luminita Elena Gatejel
Fortsetzung der Übung Kontrapunkt II. Kern ist die Erweiterung der bisherigen Fähigkeiten im zweistimmigen Kontrapunkt auf die Dreistimmigkeit, dazu kommt die Analyse von drei- und vierstimmigen Vokalsätzen der Renaissance.
- Dozent: Michael Braun
- Trainer/in: Rupert Hochholzer
- Trainer/in: Beata Gallaher
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
herzlich willkommen zur KÜ BGB im Wintersemester 24/25!
Hier findet Ihr alle wichtigen Infos und die Materialien, die wir im Laufe der Veranstaltung besprechen werden. Außerdem werde ich hier die Sachverhalte zur Vorbereitung auf die nächste Übung hochladen.
Bei Fragen, Anliegen etc. könnt ihr euch gerne einfach per Mail an mich wenden (david.linss@jura.uni-regensburg.de).
Die Einheiten finden jeweils am 19.10.2024 um 12:00 Uhr s.t. (also 12:00 Uhr) im Raum R 007 (direkt gegenüber der Recht I/Zivilrechts-Bibliothek) statt.
Folgende Einheiten entfallen aufgrund von Feiertagen etc.: 1.11.2024, 27.12.2024, 3.1.2024
David Linß
- Trainer/in: Petra Kluge
- Trainer/in: David Linß
Die Veranstaltung dient der fallbasierten und klausurorientierten Einübung des in der Vorlesung "Handels- und Gesellschaftsrecht" erlernten Stoffes. Es wird je Einheit ein Fall des Handels- und Gesellschaftsrechts behandelt. Im Vordergrund steht dabei das Zusammenspiel von bürgerlichem Recht und handels- bzw. gesellschaftsrechtlichen Regelungen und damit das Verorten handels- bzw. gesellschaftsrechtlicher Fragestellungen in klassischen Zivilrechtsklausuren. Die Veranstaltung gliedert sich in vier Blöcke:
- Grundlagen des Handelsrechts (unternehmerspezifische Regelungen im BGB, Kaufmannsstatus, Anwendungsvoraussetzungen handelsrechtlicher Regelungen; 3 Einheiten)
- Offene Handelsgesellschaft und Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Entstehung, Vertretung der Gesellschaft, Haftung der Gesellschafter; 3 Einheiten)
- Kommanditgesellschaft einschließlich GmbH & Co. KG (Sonderregelungen bei Vertretung und Gesellschafterhaftung; 2 Einheiten)
- Handelsrecht (Abweichungen vom Rechtsgeschäftslehre, des allgemeinen und besonderen Schuldrecht sowie Sachenrecht bei der Beteiligung von Kaufleuten; 4 Einheiten)
Die Übungsfälle stellen dabei auch Bezüge zu den (besonders) klausurrelevanten Regelungen des Vereins- und GmbH-Rechts her. In der letzten Einheit wird ein (größerer) Abschlussfall besprochen.
- Dozent: Maximilian Huchel
- Dozent: Fabian Kratzlmeier
Damit schulische Inklusion von Kindern mit Behinderung gelingen kann, müssen Lehrkräfte mit allen an Inklusion beteiligten Personen und Einrichtungen kooperieren: mit Eltern und Schulbegleitern, mit Logopäden und Psychologen, mit schulvorbereitenden Einrichtungen bzw. Kindergärten beim Übergang in die Grundschule, mit dem mobilen sonderpädagogischem Dienst, mit Sondereinrichtungen, weiterführenden Schulen oder Kommunen.
Im Seminar wird eine solche „Netzwerkarbeit“ in ihren Möglichkeiten für eine gemeinsame Kooperation und einen Informationsaustausch mit dem Ziel, Inklusion voranzubringen, vorgestellt und reflektiert; es werden aber auch Probleme und Grenzen, die häufig in ungünstigen schulischen Rahmenbedingungen liegen, erörtert.
- Trainer/in: Angela Enders
Kraniomandibuläre Dysfunktionen (CMD) stellen ein bedeutendes Gesundheitsproblem in der Bevölkerung dar. Die Häufigkeit der CMD liegt bei etwa 8 % der gesamten Bevölkerung. Im Kleinkindalter sind CMD-Symptome selten anzutreffen, die Häufigkeit steigt aber bis zur Pubertät stark an. Frauen im gebärfähigen Alter sind wie bei anderen Schmerzerkrankungen deutlich häufiger betroffen als Männer. Nach den Wechseljahren lassen die Beschwerden häufig nach und im Alter ist die CMD relativ selten. Zur Behandlung haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Therapiekonzepte etabliert. Dennoch stellt sich in manchen Fällen nicht der gewünschte Erfolg ein. Gründe dafür sind u. a. die Komplexität der Erkrankung und die damit verbundene erhöhte Anforderung an Diagnostik und interdisziplinärer Abstimmung der Behandler.
Kraniomandibuläre Dysfunktion oder Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD), englisch Temporomandibular joint dysfunction (TMJD), ist ein Überbegriff für strukturelle, funktionelle, biochemische und psychische Fehlregulationen der Muskel- oder Gelenkfunktion der Kiefergelenke. Diese Fehlregulationen können schmerzhaft sein, oder Ursache für Schwindelgefühle, Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Panikattacken (Herzrasen) und Stress im Alltag. Die Kraniomandibuläre Dysfunktion kann sowohl Ursache als auch Folge von Stress sein. Die Deutsche Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und -therapie definiert CMD als Sammelbegriff für eine Reihe klinischer Symptome der Kaumuskulatur und/oder des Kiefergelenks sowie der dazugehörenden Strukturen im Mund- und Kopfbereich. Die genaue Diagnose unterscheidet: Störung der Kauflächen (Okklusopathie), Störung der Kaumuskulatur (Myopathie) und Störung des Kiefergelenkes (Arthropathie). Im engeren Sinne handelt es sich dabei um Schmerzen der Kaumuskulatur („myofaszialer Schmerz“), Verlagerungen der Knorpelscheibe im Kiefergelenk („Diskusverlagerung“) und entzündliche oder degenerative Veränderungen des Kiefergelenks („Arthralgie, Arthritis und Arthrose“). In Deutschland hat sich der Begriff Kraniomandibuläre Dysfunktion (CMD) eingebürgert, ein Sammelname für diverse muskuloskelettale Beschwerden im Craniomandibulärsystem (Kausystem), daneben auch Cranio-Vertebrale Dysfunktion (CVD). In der Schweiz wird der Begriff Myoarthropathie bevorzugt, im englischen Sprachraum Temporomandibular Disorders oder temporo-mandibular-Joint-Disease (TMDs, TMJ). Die alte Bezeichnung Costen-Syndrom ist überholt. Hauptansprechpartner bei diesem Beschwerdebild ist der Zahnarzt beziehungsweise der Kieferorthopäde, betroffen sind aber viele medizinische Fachrichtungen. Aufgrund einer Vielzahl von Schmerzursachen im Kopfbereich ist bei unklarer Diagnose eine fachübergreifende Diagnostik sinnvoll. Auszuschließen sind Erkrankungen aus den verschiedensten medizinischen Fachgebieten und eine intensive konsiliarische Beurteilung ist dann unerlässlich. Die CMD stellt eine Krankheit mit vielen und wechselnden Gesichtern dar. Oft fehlt eine Korrelation zwischen dem Grad des strukturellen Schadens und der klinischen Symptomatik bzw. dessen klinischer Relevanz für Beschwerden und Therapie. Zudem zeigen sich oft wechselnde Befunde unter dem Einfluss ein Therapie als auch unabhängig davon. Auch sind Befunde teilweise erst unter dem Einfluss einer Therapie zu erkennen und oft wenig eindeutig. Die für die Therapieplanung maßgebliche Pathogenese der CMD erschließt sich oft erst aus der interdisziplinären Beobachtung der Befunde während der initialen Therapie. Zudem können während der Therapie sich ändernde Symptome oder Befunde für den weiteren Therapieweg auch für andere Behandler von Bedeutung sein. Die für die Therapie unerlässliche Compliance erfordert eine interdisziplinäre und diagnostik-gesteuerte Therapie.
Trotz der zunehmenden Bedeutung kraniomandibulärer Dysfunktionen (CMD) findet dieses Thema bislang aufgrund seiner Komplexität nur wenig Berücksichtigung in den Präsenzveranstaltungen und Curricula während des Studiums der Zahnheilkunde bzw. Medizin oder den zugehörigen Fach(zahn)arztausbildungen. Mithilfe des geplanten interaktiven und interdisziplinären Online-Kurses unter konzeptioneller soll diese prüfungsrelevante Lücke im Lehrangebot geschlossen werden und den Studenten das Thema sowie dessen Relevanz didaktisch aufbereitet näher gebracht werden. Hierzu soll zunächst in einem ersten Modul eine Einführung in das Thema CMD erfolgen und das Krankheitsbild definiert, klassifiziert und ätiologische und pathophysiologische Zusammenhänge besprochen werden. In einem zweiten Modul werden logisch gegliedert die funktionell-anatomischen Grundlagen des orofazialen und stomatognathen Systems didaktisch aufbereitet, um den Lernenden die notwendige Wissensgrundlage für eine erfolgreiche klinische Untersuchung und Diagnose der vorliegenden Störung zu ermöglichen, deren Vorgehen anhand der hierzu etablierten Apparate und Techniken im Modul 3 (Anamnese, Psychosomatik und Differentialdiagnostik), Modul 4 (Okklusionsanalyse und Kiefergelenks-Funktionsanalyse) und Modul 5 (Bildgebende Verfahren bei CMD) besprochen wird. In einem weiteren sechsten Modul werden schließlich anschaulich die derzeit verfügbaren zahnärztlichen Therapiemöglichkeiten bei CMD (Schienentherapie und prothetische Rekonstruktion) dargestellt sowie deren entsprechende Indikation unter Berücksichtigung differentialtherapeutischer Überlegungen, welche für die erfolgreiche Durchführung einer zahnärztlichen CMD-Therapie essentiell sind. Modul 7 geht daraufhin speziell auf die interdisziplinäre Therapie von CMD in Zusammenarbeit mit dem Physiotherapeuten, Osteopathen und Schmerztherapeuten ein. Im darauf folgenden Modul 8 steht die Klärung der Frage im Vordergrund, ob kieferorthopädische und kieferchirurgische Eingriffe ursächlich, präventiv oder therapeutisch bezüglich einer CMD wirken können, da dies im klinischen Patientenalltag eine häufig gestellte Frage darstellt. Im Modul 4 und 6 soll zudem unter Nutzung von Videoclips anschaulich das klinische und zahntechnische Vorgehen bei der klinischen Diagnostik sowie der Herstellung einer Michigan-Schiene zur CMD-Therapie am Beispiel eines klinisch etablierten gängigen Systems Schritt für Schritt didaktisch übersichtlich demonstriert und illustriert, sodass dem Lernenden eine direkte praktische Umsetzung der im Rahmen des Kurses erworbenen Kenntnisse zur zahnärztlich-kieferorthopädischen CMD-Therapie ermöglicht wird.
- Trainer/in: Christian Kirschneck
- Trainer/in: Johannes Pretzsch
- Trainer/in: Testaccount-vhb-PM Pretzsch
- Trainer/in: Sandra Schmid
- Trainer/in: Niklas Ullrich
Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement - Prof. Dr. Daniel Rösch
Nach Abschluss des Modules kennen und verstehen die Studierenden fortgeschrittene Methoden und Verfahren zur Modellierung und Messung von Kreditrisiken in Wissenschaft und Praxis. Die Kursteilnehmer gewinnen Fähigkeiten und Kompetenzen, um Ausfallrisiken zu modellieren und die mit Kreditportfolien verbundenen Risiken zu analysieren sowie fundierte Schlussfolgerungen zu ziehen.
Inhaltsübersicht:
1. Bankbetriebliche Risiken und (Kredit-)Risikomanagement
2. Ausfallrisikomessung auf Kontrahentenebene
3. Kreditnehmerabhängigkeiten, Portfoliorisiko und Portfoliomodelle
4. Modellierung und Messung von Recovery/LGD
5. Aufsichtsrechtliche Behandlung von Kreditrisiken (Basel II/III)
6. Kreditderivate und Verbriefungen / Strukturierte Produkte
Die theoretischen Inhalte dieser quantitativen Veranstaltung werden anhand praktischer Beispiele und Fallstudien veranschaulicht. Besonderer Wert wird bei diesem Kurs auf eine enge Verbindung zur Praxis gelegt, die insbesondere durch die Einbeziehung praxisrelevanter Modellierungstechniken und Expertenvorträge sichergestellt wird.
Die Einschreibung in den Kurs erfolgt über SPUR.
- Trainer/in: Rainer Jobst
- Trainer/in: Maximilian Nagl
- Trainer/in: Sekretariat Roesch
- Trainer/in: Daniel Rösch
Als Kreolsprache bezeichnet man eine Sprache, die in einer Situation entstand, in der Bevölkerungsgruppen ohne gemeinsame Sprache aufeinandertrafen und sich untereinander verständigen mussten. Der Begriff wird insbesondere für im Zusammenhang mit der europäischen Kolonisation und dem transatlatischen Sklavenhandel entstandene Sprachen verwendet. Bekannte Beispiele sind Haitianisch, das jamaikanische Patois und Tok Pisin, die Nationalsprache Papua Neuguineas.
Kreolsprachen zeichnen sich dadurch aus, dass sie den grössten Teil ihres Wortschatzes der in der Kontaktsituation dominanten Sprache entnehmen – im kolonialen Kontext ist dies die Kolonialsprache. Sie unterscheiden sich jedoch deutlich von der Kolonialsprache in Bezug auf das Lautsystem und die Grammatik. Viele grammatische Strukturen gleichen denen der in der Kontaktsituation untergeordneten Sprachen. Kreolsprachen wurden lange geringschätzig als rudimentäre Kommunikationssysteme und vereinfachte Versionen der jeweiligen Kolonialsprache bezeichnet.
Da ihre Geschichte relativ gut dokumentiert ist, sind Kreolsprachen für Linguisten besonders interessant als Fallbeispiele für sprachlichen Wandel und Sprachentwicklung. Überdies geben sie auch einige Rätsel auf: So gibt es einige typische Strukturen, die sich in allen Kreolsprachen finden, auch wenn sie keinen Kontakt untereinander hatten. Bis heute gibt es keine universell akzeptierte Theorie, die diese Gemeinsamkeiten erklärt.
Dieser Kurs bietet einen Überblick über die Kreolistik. Wir betrachten verschiedene Szenarien, unter denen Kreolsprachen entstanden sind und lernen Theorien zu ihrer Entstehung kennen. Überdies wird schauen wir die Struktur einiger ausgewählter Kreolsprachen genauer an; dabei sollen Sprachen, die auf den wichtigen Kolonialsprachen Englisch, Französisch und Portugiesisch basieren, repräsentiert werden. Zuletzt gehen wir auf einige Probleme der Kreolistik ein, zum Beispiel, ob ob Kreolsprachen tatsächlich einfacher sind als andere Sprachen, und ob es sich bei Kreolsprachen wirklich um einen definierbaren, eigenen Sprachtyp handelt.
- Trainer/in: Juliette Huber
Das 20. Jahrhundert markiert den Beginn der Auseinandersetzung mit Soldaten, die im Krieg psychisch auffällig geworden waren. Im Ersten Weltkrieg florierten für diese Auffälligkeit Begriffe wie „shell-shock“ (Großbritannien), „Kriegsneurose“ (Deutschland) oder „Quetschung“ (Russland), im Zweiten Weltkrieg kamen andere Begriffe hinzu. Im Seminar soll mit Schwerpunkt auf die beiden Weltkriege und auf Ost- und Südosteuropa gefragt werden, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich im Umgang mit psychisch versehrten Soldaten erkennen lassen. Dabei wird der Arbeit mit Quellenmaterial – psychiatrische Patientenakten – ein besonderes Schwergewicht zukommen. Denn die Spezifika des Umganges mit psychischer Kriegsversehrtheit können insbesondere auch im mikrohistorischen Zugriff auf die Patientenakten und die hier konkret werdenden klinischen Praktiken sichtbar gemacht werden.
Der Kurs ist am dem 20. April sichtbar, wird aber erst am 4. Mai starten.
- Trainer/in: Heike Karge
Die Kriegsgeschädigtenpolitik gilt als ein „Vorbote des Wohlfahrtsstaates“ (Geyer). Nach dem Ersten Weltkrieg stellten die Kriegsverletzten innerhalb der Veteranenbewegung eine Gruppe mit besonderen Bedürfnissen und einer eigenen Agenda dar; sie bildeten national und international eine große und politisch ernstzunehmenden soziale Bewegung. Dies gilt nicht nur für die Ex-Kombattanten der ‚alten‘ (westlichen), sondern auch für jene der ‚neuen‘ auf den Territorien der niedergegangenen Großreiche errichteten Nationen. Deren gemeinsames Engagement für Sozialfürsorge und Friedenserhalt manifestierte sich nicht zuletzt in der internationalen Kriegsgeschädigtenorganisation CIAMAC (Conférence internationale des associations de mutilés de guerre et anciens combattants / Internationale Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Kriegsopfer und früheren Kriegsteilnehmer). Das Seminar widmet sich der Genese, Entfaltung und Wirkung der entsprechenden Verbände auf nationaler Ebene wie auch in internationaler Perspektive. Der Blick richtet sich dabei besonders auf die Verbände auch Ostmittel und- Südosteuropas.
Von den Studierende wird regelmäßige Teilnahme und aktive Beteiligung nach vorbereitender Lektüre sowie ein Referat erwartet. Das Hauptseminar schließt mit einer Hausarbeit ab.
- Trainer/in: Natali Stegmann
Seminarbeschreibung:
Dass in den letzten Jahren häufig von einer goldenen Ära des Fernsehens gesprochen wird, hat viel mit Formaten des sogenannten ‚quality television‘ wie The Wire oder The Sopranos zu tun. Offensichtlich hat sich das Fernsehen durch ambitionierte, innovative Serien von einer ihm lange zugesprochenen ästhetischen Rückständigkeit befreit. Doch dieser Eindruck täuscht. Durch das Nachzeichnen einer Geschichte des ‚quality television‘ vom frühen Fernsehen bis heute soll in dem Seminar deutlich gemacht werden, dass es Qualität immer gegeben hat. Der Begriff bezieht sich aber weniger auf eine objektiv feststellbare ästhetischen Komplexität, sondern bezeichnet unterschiedliche Strategien, Diskurse, stilistische Optionen, die mit den Veränderungen der Fernsehökonomie, Distributionsformen und Zuschauerschaft des Fernsehens zu tun haben. Die Beschäftigung mit ‚quality‘ bietet daher auch die Möglichkeit, die Ästhetik des Fernsehens, seinen Ort in der Kultur und seine Rezeption besser zu verstehen. Neben der Lektüre wichtiger Texte zum Begriff ist auch die Sichtung und Diskussion ausgewählter Beispiele von ‚quality television‘ wie Requiem for a Heavyweight (1950er Jahre), Roots (Jahre 1970er Jahre), Twin Peaks (1990er Jahre), The Sopranos (2000er Jahre) oder House of Cards (2010er Jahre) Gegenstand dieses Seminars.
Grundlage des Scheinerwerbs sind Referat und Hausarbeit.
- Trainer/in: Herbert Schwaab
- Trainer/in: Lidija Cvikic
Konversationsübung zur Vorlesung Bau- und Kommunalrecht im WiSe 24/25 von Prof. Manssen
- Trainer/in: Sophie Bittl
Herzlich Willkommen im GRIPS-Kurs zur Erstsemester-KÜ (12. Parallelgruppe) im Staatsorganisationsrecht im Sommersemester 2024.
Die Konversationsübung findet immer Mittwochs von 18-20 Uhr c.t. in R 007 statt.
Hier finden Sie vor den Veranstaltungen die Sachverhalte sowie im Nachgang eine ausformulierte Lösung sowie die PowerPoint-Folien.
- Trainer/in: Tarek Mahmalat
Liebe TeilnehmerInnen,
ich gebe das kommende Wintersemester montags von 18:00-19:30 Uhr (Gruppe 1) in H7 die KÜ StR AT II.
Die erste Einheit findet am 14.10.2024 statt.
Die Sachverhalte werden vorab hier im Kurs hochgeladen. Es macht Sinn, sich vorbereitend mit den Fällen zu beschäftigen. Die restlichen Materialien werden nach der KÜ hochgeladen.
Vergesst bitte nicht, euch bei FlexNow für die KÜ-Teilnahme anzumelden!
Bei Fragen, Wünschen, Anregungen oder Kritik könnt ihr gerne auf mich zukommen!
(Maximiliane.Aust@jura.uni-regensburg.de oder Sprechstunde nach Vereinbarung im Büro VG 3.46)
- Trainer/in: Maximiliane Aust
- Trainer/in: Juniorprofessur Christoph
Kommunikation ist essentieller Bestandteil des menschlichen Alltagslebens – und damit natürlich auch jeder Wissenschaft. Da sich Wissenschaften jeweils einer eigenen Fachterminologie bedienen und mit bestimmten Begrifflichkeiten, sowie deren Konzepten und damit verbundenen Theorien, intensiv auseinandersetzen, dient dieses Seminar der Einführung in Grundbegriffe der Vergleichenden Kulturwissenschaft. Dabei wird der Zugang nicht nur über Begriffsdarlegungen geschaffen, sondern auch über die kontextuelle Einbettung in kulturwissenschaftliche Forschungsbereiche und Alltagsphänomene.
- Trainer/in: Karin Lahoda
Dieser Kurs bietet Studierenden des Studiengangs Public History und Kulturvermittlung kompakte Einblicke in das Fachverständnis sowie die Arbeitsweise der Vergleichenden Kulturwissenschaft. Konsekutive Masterstudierende können ihre bisherigen Fachkenntnisse weiter vertiefen.
Die Beschäftigung mit fachgeschichtlichen Traditionslinien – von den Anfängen einer wissenschaftlichen Volkskunde bis zur heutigen Vergleichenden Kulturwissenschaft – und die Betrachtung von Forschungsfeldern, Theorien sowie Methoden schaffen die Grundlage für eine Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Aufgaben des Faches innerhalb einer internationalen Wissenschaftslandschaft.
Was sind Faustregeln, wo kommen sie zum Einsatz und inwiefern lässt sich dieser Begriff für die medientheoretische Analyse sogenannter künstlicher Intelligenz fruchtbar machen? Um diesen Fragen nachzugehen, richtet sich dieses Seminar sowohl auf begriffliche Theoriearbeit als auch auf die geschichtliche Auseinandersetzung mit den Sujets der künstlichen Intelligenz, der Faustregel und des Algorithmus aus. Im Sinne einer engen Verzahnung von Forschung und Lehre lädt die Veranstaltung Studierende zum aktiven Forschen ein, wenn die in Frage stehenden Konzepte gemeinsam exploriert und die Eignung alternativer Begriffe – wie dem der Faustregel – zu bestehenden und womöglich festgefahrenen Auffassungen von Algorithmen und Computerprozessen platziert und diskutiert werden.
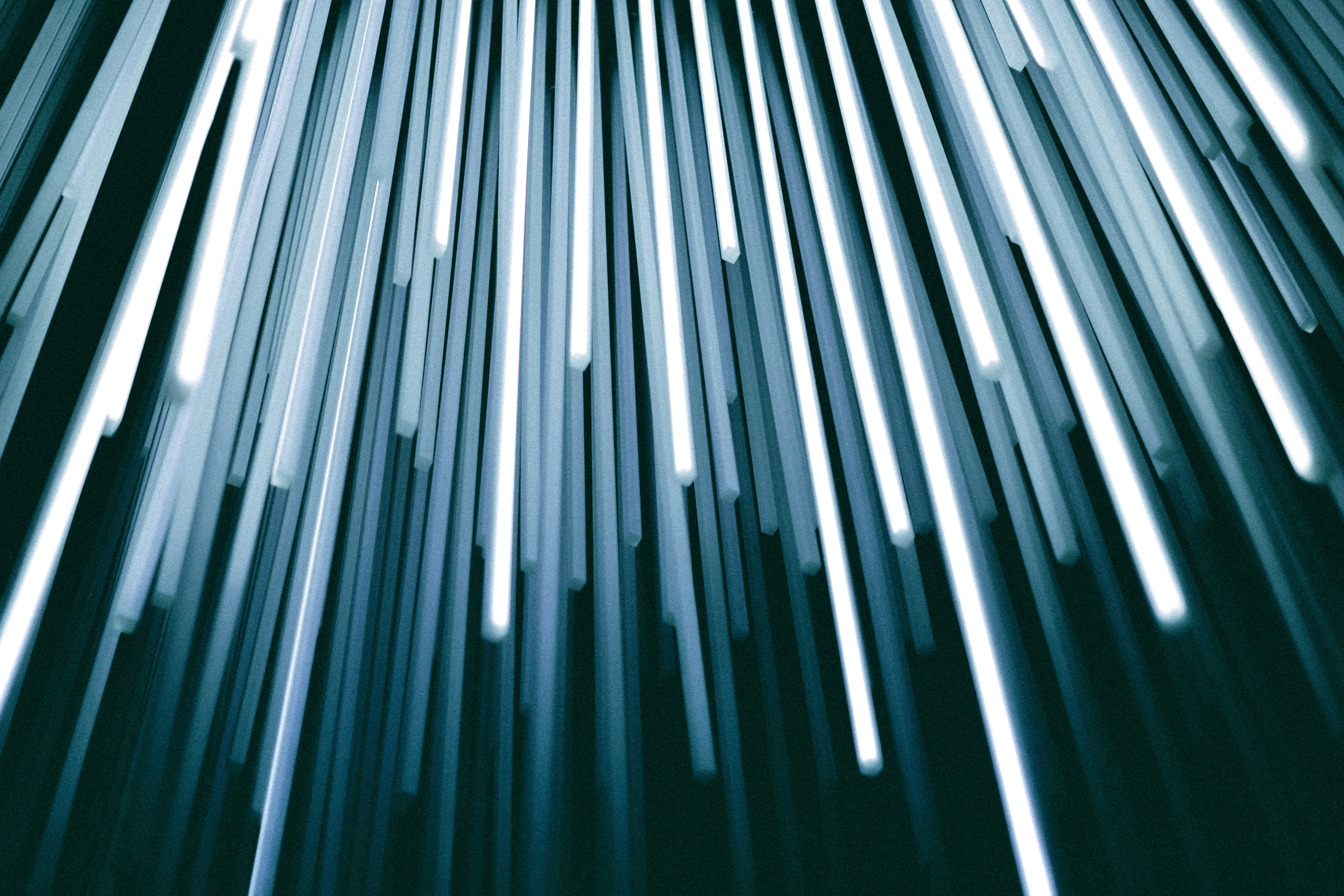
- Trainer/in: Thomas Nyckel
- Mo 8.4.24 Begriffsdefinition KI, "Risiken und Nebenwirkungen" von KI
- Di. 9.4.24 Begriffsdefinition digitale Barrierefreiheit, geeignete Einsatzbereiche für KI
- Mi. 10.4.24 Mit KI -Tools Kommunikationsbarrieren überwinden: Übersetzungen in LEICHTE SPRACHE mit SUMM AI
- Do. 11.4.24 KI-Tools für Bilder für kreatives Arbeiten nutzen
- Fr. 12.4.24 KI- Tools für Musik und Stimme
- Sa. 13.4.24 Präsenztag mit praktischen Beispielen, Diskussion mit Experten, Evaluation
- Trainer/in: Gaby Eisenhut
Herzlich Willkommen im Kurs Ungarische Landeskunde II!
Nach der
Einführung zur ungarischen Kulturgeschichte von der Landnahme (896) bis
zur Wende (1989/1990) im Kurs I. wenden wir uns in diesem Kurs II.
verstärkt Ereignissen im 20./21. Jahrhundert zu.
Sie werden am Ende
dieser Übung anhand von Lernmaterialien (Texten, Videos, anschaulichen
Folien) einschätzen können, wie sich die Situation der aktuellen
ungarischen Gesellschaft aus der Perspektive unterschiedlicher
Generationen in Bezug auf Arbeit, Bildung, Gesundheit gestaltet
(ungarische Studierende, junge Familien, Rentner).
Am Beispiel der
Situation der Roma und der deutschen Minderheit in Ungarn, werden auch
Fragen der Beziehung zwischen der Mehrheitsgesellschaft und den
Minderheiten thematisiert.
In der zweiten Kurshälfte werden Sie
schlaglichtartig einige herausragende Persönlichkeiten aus der
ungarischen Literatur, Musik und dem Film kennenlernen.
- Trainer/in: Krisztina Busa
Herzlich Willkommen im Kurs Ungarische Landeskunde II!
Nach der
Einführung zur ungarischen Kulturgeschichte von der Landnahme (896) bis
zur Wende (1989/1990) im Kurs I. wenden wir uns in diesem Kurs II.
verstärkt Ereignissen im 20./21. Jahrhundert zu.
Sie werden am Ende
dieser Übung anhand von Lernmaterialien (Texten, Videos, anschaulichen
Folien) einschätzen können, wie sich die Situation der aktuellen
ungarischen Gesellschaft aus der Perspektive unterschiedlicher
Generationen in Bezug auf Arbeit, Bildung, Gesundheit gestaltet
(ungarische Studierende, junge Familien, Rentner).
Am Beispiel der
Situation der Roma und der deutschen Minderheit in Ungarn, werden auch
Fragen der Beziehung zwischen der Mehrheitsgesellschaft und den
Minderheiten thematisiert.
In der zweiten Kurshälfte werden Sie
schlaglichtartig einige herausragende Persönlichkeiten aus der
ungarischen Literatur, Musik und dem Film kennenlernen.
- Trainer/in: Krisztina Busa
Auch wenn der Veroneser Dichter Catull bereits in jungen Jahren verstarb und ein Werk von überschaubarem Umfang hinterließ, das nur durch eine einzige Handschrift überliefert wurde, sind Bekanntheit und Beliebtheit des Autors bis heute groß. Nicht nur das Lob des Urlaubsortes Sirmione am Gardasee (Catull. 31,1f. Paene insularum, Sirmio, insularumque ocelle) ermöglicht eine Identifikation mit dem Dichter, auch in die Geschichte des Liebens und Leidens mit Lesbia vermag sich der moderne Leser hineinzuversetzen. Der Inhalt von Catulls Gedichten unterscheidet sich durch leidenschaftliche, subjektive Liebesdarstellung, auch durch hemmungslose Obszönitäten und bissigen Spott gegenüber hochgestellten Persönlichkeiten radikal von der zuvor gewohnten römischen Dichtung.
In der Form gingen Catull und seine literarischen Mitstreiter ebenfalls neue Wege: In Anlehnung an den Ausspruch des Kallimachos, ein großes Buch sei ein großes Übel, schufen die sogenannten Neoteriker im Sinne ihres Ideals vom universal gebildeten poeta doctus gelehrte, ausgefeilte Kleindichtung. Neben den berühmtesten, aus der Schule bekannten Gedichten über die aufreibende und verzehrende Liebe zu Lesbia, den scharfen Angriffen auf Caesar und seinen Günstling Mamurra stellen unter anderem die Epyllien der sogenannten carmina maiora (Catull. 61–68), durchkomponierte, anspielungsreiche Kleinepen zu mythologischen Themen, einen wesentlichen Bestandteil des Werkes des Dichters dar.
Im Kurs soll das gesamte Werk des Dichters thematisiert werden; neben der gründlichen sprachlichen und inhaltlichen Erschließung der repräsentativen Gedichte werden auch Aspekte der Metrik, Textkritik und des historischen und literarischen Hintergrundes behandelt.
Textgrundlage:
Catulli Carmina, ed. R. A. B. Mynors, Oxford 1958 (OCT).
- Trainer/in: Bernhard Paul
Auch wenn der Veroneser Dichter Catull bereits in jungen Jahren verstarb und ein Werk von überschaubarem Umfang hinterließ, das nur über eine einzige Handschrift überliefert wurde, ist die Beliebtheit des Autors ungebrochen. Nicht nur das Lob des heute noch gefragten Urlaubsortes Sirmione am Gardasee (31,1f. Paene insularum, Sirmio, insularumque ocelle) ermöglicht eine Identifikation mit dem Dichter, auch in die Geschichte des Liebens und Leidens mit Lesbia vermag sich der moderne Leser hineinzuversetzen. Der Inhalt von Catulls Gedichten unterscheidet sich durch leidenschaftliche, subjektive Liebesdarstellung, auch durch hemmungslose Obszönitäten und bissigen Spott gegenüber hochgestellten Persönlichkeiten radikal von der bisherigen römischen Dichtung.
Auch in der Form gingen Catull und seine literarischen Mitstreiter neue Wege: In Anlehnung an den Ausspruch des Kallimachos, ein großes Buch sei ein großes Übel, schufen die sogenannten Neoteriker im Sinne ihres Ideals vom universal gebildeten poeta doctus gelehrte, ausgefeilte Kleindichtung. Neben den berühmtesten, aus der Schule bekannten Gedichten über die aufreibende und verzehrende Liebe zu Lesbia, den scharfen Angriffen auf Caesar und seinen Günstling Mamurra stellen unter anderem die Epyllien der sogenannten carmina maiora (Catull. 61–68), durchkomponierte, anspielungsreiche Kleinepen zu mythologischen Themen, einen wesentlichen Bestandteil des Werkes des Dichters dar.
Im Kurs soll das gesamte Werk des Dichters thematisiert werden; neben der gründlichen sprachlichen und inhaltlichen Erschließung der Gedichte werden auch Aspekte der Metrik, Textkritik und des historischen und literarischen Hintergrundes behandelt sowie die dazu nötigen Arbeitstechniken eingeübt.
- Trainer/in: Bernhard Paul
In diesem Kurs - "Leben und Kultur im Mittelalter" - lernt ihr die Struktur der mittelalterlichen Gesellschaft kennen, erfahrt was Grundherrschaft, Lehenswesen und Ständeordnung bedeutet, bekommt einen Einblick in das Leben auf dem Land, im Kloster oder in der Stadt. Ihr erfahrt mithilfe von Quellen und Darstellungen etwas für die verschiedenen Berufe und Lebensvorstellungen der mittelalterlichen Menschen. Neben der höfischen Kultur und dem Rittertum setzt ihr euch auch mit den äußeren Bedrohungen, wie bspw. Kriege oder der Pest, auseinander, um, mithilfe verschiedener Übungen und abwechslungsreicher Aufgaben, einen breitgefächerten Einblick in die Kultur und das Leben im Mittelalter zu gewinnen.
- Trainer/in: Laura Klauer
- Trainer/in: Simon Fröbus
Dies ist ein Online-Kurs. Materialien und Informationen werden über GRIPS und Email wöchentlich kommuniziert.
Neben der Lektüre von Texten müssen wöchentlich kleinere Hausaufgaben schriftlich erledigt und virtuell eingereicht werden. Am Ende der Vorlesungszeit ist eine kurze schriftliche Abschlussreflexion zur Lektüregrundlage zu verfassen.
Synchrone Sitzungen (Zoom) wird es nach Vorankündigung in Form von Gruppendiskussionen oder Besprechungen geben.
Wenn Sie einen Platz im Kurs zugeteilt bekamen, werden Sie per E-Mail den Einschreibeschlüssel erhalten. Schreiben Sie damit umgehend in den GRIPS-Kurs ein, spätestens bis zum 06.11.20.
Bitte beachten Sie im Folgenden ferner die inhaltliche Kursbeschreibung: https://lsf.uni-regensburg.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung&veranstaltung.veranstid=157508
(Detailliertere Informationen werden im Kurs beim Kurs-Start bereitgestellt).
- Trainer/in: Solveig Ottmann
Dies ist ein Online-Kurs. Materialien und Informationen werden über GRIPS und Email wöchentlich kommuniziert.
Neben der Lektüre von Texten müssen wöchentlich kleinere Hausaufgaben schriftlich erledigt und virtuell eingereicht werden. Am Ende der Vorlesungszeit ist eine kurze schriftliche Abschlussreflexion zur Lektüregrundlage zu verfassen.
Synchrone Sitzungen (Zoom) wird es nach Vorankündigung in Form von Gruppendiskussionen oder Besprechungen geben.
Wenn Sie einen Platz im Kurs zugeteilt bekamen, werden Sie per E-Mail den Einschreibeschlüssel erhalten. Schreiben Sie damit umgehend in den GRIPS-Kurs ein, spätestens bis zum 06.11.20.
Bitte beachten Sie im Folgenden ferner die inhaltliche Kursbeschreibung: https://lsf.uni-regensburg.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung&veranstaltung.veranstid=157508
(Detailliertere Informationen werden im Kurs beim Kurs-Start bereitgestellt).
- Trainer/in: Solveig Ottmann
Der Zugang zu verschiedenen geistigen Strömungen gelingt am besten über die Lektüre ihrer Quellentexte; diese wiederum kommen besonders dann in ihrer gesamten sprachlichen Tiefe zur Geltung, wenn sie im Original gelesen werden.
Der Lektürekurs möchte einen solchen Zugang zu einem grundlegenden Werk der christlichen Spiritualität und Mystik geben: Die Confessiones des Augustinus, ein Werk, das zwischen Autobiographie und religiöser Didaktik schwankt: In dem Augustinus versucht, nicht nur sich selbst, sondern auch Grund und Grundbedingungen menschlicher Existenz zu erforschen.
Erforderlich für die Teilnahme sind grundlegende Kenntnisse des Lateinischen; deren Wiederholung und Vertiefung stellt dabei ein zweites Lernziel des Kurses dar.
- Trainer/in: Marko Jovanovic
Spätestens seit dem PISA-Schock ist klar: Ein großer Teil der dt. Schüler/-innen hat erhebliche Probleme Texte angemessen zu verstehen. In literalen Gesellschaften gehört Lesen zu den Schlüsselqualifikationen und ermöglicht erst die Teilnahme am kulturellen Leben. Der Einsatz und die Entwicklung effektiver Fördermaßnahmen zum Aufbau von Lesekompetenz sind damit eine zentrale Aufgabe schulischen Unterrichts. Ein Überblick über die neuesten Ergebnisse der Leseforschung und -didaktik gehört daher zum Grundlagenwissen jeder Deutschlehrkraft, auch um den heterogenen Schwierigkeiten und Fehlern Ihrer Schüler/-innen zu begegnen.
- Trainer/in: Maria Steinert
Lernorte
des Glaubens.
Versuch einer religionspädagogischen Topologie
Places to learn faith. Developing a topology of religious education
VORLESUNG (M, Vertiefungsmodul 6: Religionspädagogik)
Donnerstag, 10 bis 12 Uhr (2 st)
Angesichts einer Fixierung auf den schulischen Religionsunterricht droht hierzulande in Vergessenheit zu geraten, dass außerschulische Lernorte prädestiniert sind, ein „learning religion“ zu ermöglichen, das bejahende Glaubenspraxis erlebbar und zugänglich werden lässt. Die Vorlesung erkundet Kontexte, Konzepte und Konkretisierungen solchen Glaubenlernens, das komplementär ist zum ebenso notwendigen „learning from religion“ und „learning about religion“.
Einführende Literatur:
Peter
Scheuchenpflug, „Den Glauben
vorschlagen in der heutigen Gesellschaft“. Impulse des Dialogprozesses in
Frankreich für die Evangelisierung in Deutschland, in: Lebendiges Zeugnis 56
(3/2001) 220-229
Burkard Porzelt,
Rolle rückwärts? Der Youcat als Versuch der Wiederbelebung erfahrungsferner
Glaubenslehre, in: Renovatio 68 (1-2/2012) 48-51
David Wakefield, Schulfrei – Kirchliche Bildung jenseits der
Schule, in: Kat.Bl. 141 (2/2016) 146-151
- Trainer/in: Burkard Porzelt
Lernorte des Glaubens. Versuch einer religionspädagogischen Topologie
Places to learn faith. Developing a topology of religious education
VORLESUNG (M, Vertiefungsmodul 6: Religionspädagogik)
Donnerstag, 10 bis 12 Uhr (2 st); W 115
Angesichts einer Fixierung auf den schulischen Religionsunterricht droht hierzulande in Vergessenheit zu geraten, dass außerschulische Lernorte prädestiniert sind, ein „learning religion“ zu ermöglichen, das bejahende Glaubenspraxis erlebbar und zugänglich werden lässt. Die Vorlesung erkundet Kontexte, Konzepte und Konkretisierungen solchen Glaubenlernens, das komplementär ist zum ebenso notwendigen „learning from religion“ und „learning about religion“.
Einführende Literatur:
Burkard Porzelt, Rolle rückwärts? Der Youcat als Versuch der Wiederbelebung erfahrungsferner Glaubenslehre, in: Renovatio 68 (1-2/2012) 48-51; Joachim Kunstmann, Ein Ort für das Leben. Der Weg zur religiösen Erneuerung der Kirche, Gütersloh (Gütersloher Verl.‑Haus) 2022.
- Trainer/in: Burkard Porzelt
Ob Asterix-Comics, Indianergeschichten, Mittelalterfeste oder die Burg im eigenen Ort: Schülerinnen und Schüler sind tagtäglich umgeben von einer Geschichtskultur, die Fragen und Unverständnis aufwirft, teilweise aber auch Fehlvorstellungen erzeugt. Die historische Perspektive im Sachunterricht setzt genau an dieser Stelle an: Oberstes Ziel des historischen Lernens ist im Sachunterricht wie im späteren Geschichtsunterricht der Sekundarstufe die Entwicklung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins. Dieses Seminar stellt die Themenbereiche der historischen Perspektive sowie deren Unterrichtsprinzipien vor, erläutert zentrale historische Kompetenzen und vermittelte konkrete Inhalte für die Planung und Durchführung von Unterrichtsstunden in der historischen Perspektive des Sachunterrichts.
Die Veranstaltung findet asynchron über GRIPS mit synchronen Elementen über Zoom statt.
E-Prüfung oder 2 in 24 h Hausarbeit, je nach Infektionslage
Prüfungstermin 15.07. 14-16 Uhr
- Trainer/in: Johannes Haider
Ob Asterix-Comics, Indianergeschichten, Mittelalterfeste oder die Burg im eigenen Ort: Schülerinnen und Schüler sind tagtäglich umgeben von einer Geschichtskultur, die Fragen und Unverständnis aufwirft, teilweise aber auch Fehlvorstellungen erzeugt. Die historische Perspektive im Sachunterricht setzt genau an dieser Stelle an: Oberstes Ziel des historischen Lernens ist im Sachunterricht wie im späteren Geschichtsunterricht der Sekundarstufe die Entwicklung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins. Dieses Seminar stellt die Themenbereiche der historischen Perspektive sowie deren Unterrichtsprinzipien vor, erläutert zentrale historische Kompetenzen und vermittelte konkrete Inhalte für die Planung und Durchführung von Unterrichtsstunden in der historischen Perspektive des Sachunterrichts.
Die Veranstaltung findet asynchron über GRIPS mit synchronen Elementen über Zoom statt.
E-Prüfung oder 2 in 24 h Hausarbeit, je nach Infektionslage
Prüfungstermin 15.07. 14-16 Uhr
- Trainer/in: Johannes Haider
- Trainer/in: Julia Lechner
- Trainer/in: Luisa Pöppel
Die Wissenschaft und Praxis der Lese- und Sprachförderung in der Schule werden thematisiert.
- Trainer/in: Sebastian Suggate
Lesekompetenz ist eine grundlegende Fähigkeit, deren Entwicklung und Förderung bereits in der Grundschule eine essenzielle Rolle spielt. Aus diesem Grund gibt dieses Seminar einen Überblick über die Kompetenzmodelle und über die grundlegenden Erkenntnisse aus der Leseforschung unter Bezugnahme auf empirische Leistungsstudien wie IGLU und PISA. Das Seminar fokussiert sich auf die diagnostischen Fähigkeiten von Lehrkräften, Aussagen über Lernstände treffen zu können. Ebenso werden verschiedene Ansätze und Methoden zur Förderung der Lesekompetenz besprochen, einschließlich der Integration digitaler Medien.
- Trainer/in: Markus Pabst
| Kommentar |
The course is based on the holistic approach of „Orff Schulwerk“ and music for all. The idea is that singing or playing is never an isolated phenomenon, but that rhythm, melody, words and movements are all closely linked and intertwined. Music and movements or dance are a significant part of being human and should be practised and encouraged in every age group as a part of being. – Emphasis is on musical games and movement, children’s rhymes and dances. The aim is to give insight into how every primary school teacher can work with music and dance in his classroom. The focus will be on how we can apply the core elements of the „Orff approach“ in the (music) classroom using games, improvisation, ostinatos and various musical form as a gateway for student’s creativity in music. Through students, one’s experiments, an opportunity to learn together and from others in a group is created. |
|---|---|
| Literatur |
Hermann Regner (1977): Music for children. Orff Schulwerk, American Edition. Bases on Carl Orff and Gunild Keetmann. Mainz: Schott. |
- Trainer/in: Magnus Gaul
Bereits die zweite Welle der Frauenbewegung der späten 1960er- und 1970er-Jahre skandierte: „Das Private ist politisch“. Dass Sexualität im Kern des Privaten verortet ist, macht sie jedoch keineswegs zu einem (kultur)wissenschaftlichen Nischenthema – sie stellt ein kulturell überformtes, sozial organisiertes und mit Herrschaftsmechanismen verzahntes Phänomen dar: Medizin, Staat, Recht, (digitale) Technologien, Ökonomie, Gesundheit oder Religion sind nur einige der zahlreichen Determinanten, die das Sprechen über und das Praktizieren von Sexualität auf Makro- und Mikroebenen prägen (Koch).
Innerhalb der Vergleichenden Kulturwissenschaft nahmen sich bereits in den 1980er- und 1990er-Jahren einige Publikationen der aufklärerischen Pathologisierung von Onanie im 18. Jahrhundert (Braun) an oder beschäftigten sich mit Sexualmoralen und -praxen am Beispiel von Unterschichten im 19. und frühen 20. Jahrhundert (Lipp; Kienitz). Während primär Nachwuchswissenschaftler:innen und Studierende reges Interesse an Sexualität betreffenden Fragestellungen zeigen, sind zentrale Studien, die sich der Sexualität in ihren alltagskulturellen Dimensionen historisch wie gegenwartsorientiert zuwenden, inzwischen rar gesät – an dieses Desiderat knüpften auch die 33., 2021 in Hamburg ausgerichtete DGV-Studierendentagung „Sex.Sex.Sex. Kulturwissenschaftliche Höhepunkte und Abgründe“ sowie der aus ihr hervorgehende Tagungsband an.
Das Hauptseminar nimmt eine theoretische wie historische Fundierung jenes vulnerablen Themenfelds vor. Einer diachronen Perspektive folgend, die sich von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart erstreckt, erforschen die Teilnehmenden Wissensproduktionen über Sexualität, das Spannungsfeld von Norm und Praxis, nicht-lineare Prozesse der Liberalisierung, die Kommodifizierung von Körpern sowie die Wirkmacht sexuellen Kapitals. Dabei greifen sie mittels historisch-archivalischer Zugänge, qualitativer Interviews, Medienanalysen und Social-Media-Ethnografien auf ein breites methodisches Spektrum zurück.
- Trainer/in: Alexandra Regiert
Entgegen dem oft apostrophierten Gegensatz von Wirtschaft und schöner Literatur kann die Verschränkung beider Domänen nicht geleugnet werden: Zum Einen ist die Entwicklung der Literatur ohne die Kommerzialisierung des Buchmarktes nicht möglich gewesen, zum Anderen nimmt die Literatur an der Entwicklung der Ökonomie in vielfältiger Weise teil. Speziell im Russland des 19. Jhs. werden fiktionale Geschichten mit Geldschicksalen in Verbindung gebracht, womit der Unternehmer als Figur ins Zentrum literarischer Aufmerksamkeit rückt. Ausgehend von den literaturhistorischen Fragestellungen ist es das Ziel des Seminars, anhand ausgewählter Texte, das Geldsujet in der russischen Literaturklassik transparent und lesbar zu machen. Angebot und Nachfrage, Kredit und Zins sowie die Probleme des Privateigentums werden dabei genauso in den Blick genommen wie die ethnisch-moralische Bewertung des unternehmerischen Handelns. Hierzu werden neben literarischen Werken (Gogol, Gončarov, Tolstoj, Čechov) auch ökonomische und kulturanthropologische Quellen (Smith, Marx, Weber) gelesen und erarbeitet.

- Trainer/in: Oleksandr Zabirko
Noch immer wird wie selbstverständlich von einer „deutschen“
Literaturgeschichte gesprochen, die einen zentralen Gegenstand der NDL
darstellt. Tatsächlich handelt es sich aber bei der nationalen
Zuschreibung um eine starke Verkürzung, denn quasi alle literarischen
Epochen der „deutschen“ Literatur sind in ihrer Entstehung kaum zu
verstehen, wenn nicht die Impulse und die Reaktionen aus den
Entwicklungen anderer Literaturen berücksichtigt werden. „Fast keine
jener Formen, in denen in deutscher Sprache seit dem Aufkommen der
Schriftlichkeit gedichtet wurde, ist in deutschsprachigen Gegenden
entwickelt worden, fast alle sind von außen gekommen, sind Import.“
(Kelletat) Mit „Import“ ist konkret das Nachahmen, Nachdichten und vor
allem das literarische Übersetzen gemeint. Was also bislang oft zu kurz
kommt, ist die Einbeziehung und angemessene Würdigung der Übersetzungs-
und Adaptionsschübe in der deutschen Literatur. Im Grunde geht es um
eine Geschichtsschreibung literarischen Übersetzens, um eine Erforschung
der Kulturgeschichte des Übersetzens als Provokation, als Korrektiv
nationaler Literaturgeschichtsschreibung. Von dieser Grundlage ausgehend
möchte das Seminar daher eine Perspektive auf die deutsche
Literaturgeschichte als Übersetzungsgeschichte anhand ausgewählter
Querschnitte entwickeln. Nach einer Lektüre von Theorie-Texten zur
Interaktion von Literaturgeschichte und Übersetzung werden u.a. folgende
ausgewählte literaturgeschichtliche Epochen anhand von wegweisenden
Übersetzungen und ihrer Funktionen thematisiert: Aufklärung (Wielands
Shakespeare-Übersetzungen, Lessings Diderot-Übersetzungen), Sturm und
Drang (Herders Oßian und die Lieder alter Völker, Lenz‘
Plautus- und Shakespeare-Übersetzungen), Klassik (Voß‘
Homer-Übersetzungen und Goethes Poetik des Übersetzens), Romantik
(Shakespeare-Übersetzungen von den Brüder Schlegel und Tieck), Paul
Celans Übersetzungen französischer und russischer Lyrik, Übersetzen als
Nachdichten in der DDR-Lyrik, Übersetzen und Weltliteratur heute
(Walkowitz: Born translated. The contemporary novel in an age of world literature).
- Trainer/in: Heribert Tommek
Das Citavi-Tutorium hilft euch bei der Bachelorarbeit. Damit Quellen verwalten, euer Wissen kategorisieren und strukturieren. Einmal gelernt, spart euch das Programm viel Zeit und Mühe beim richtigen Zitieren. Diese Software ist nur mit Windows kompatibel.
- Trainer/in: Bianca Burkert
- Trainer/in: Sabrina Viehauser
| Kommentar |
Nach einem Rückblick auf fünfzig Jahre Popdidaktik wird die aktuelle Situation der unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Berücksichtigung von Pop, Jazz und Rock in der Schule durch Text- und Videoanalysen sowie durch Diskussionen ausführlich beleuchtet. Gleichzeitig werden exemplarisch die Möglichkeiten und Grenzen des Online-Unterrichts am Beispiel des Live-Arrangements thematisiert. Live-Arrangements verbinden Kompositions- und Arrangiertechnik mit pädagogischem Handeln. Vokale und instrumentale Praxis Populärer Musik können davon in hohem Maße profitieren. Ziel und Ergebnis sind Musikstücke, die spontan und prozessorientiert während der Einstudierung entwickelt werden. Alle Mitmachenden haben so kreativen Anteil am schöpferischen Geschehen und findet sich gleichsam in der Mitte des musikdidaktischen Geschehens. Videoclips werden einen anschaulichen Einblick in die professionelle Umsetzung wichtiger Prinzipien des Klassenmusizierens mit Pop-Arrangements geben. |
|---|---|
| Literatur |
Jürgen Terhag und Jörn Kalle Winter (2011): Live-Arrangement. Vom Pattern zur Performance. Mainz: Schott. |
- Trainer/in: Magnus Gaul
Dieses gemeinsame Seminar der Germanistik in Łódź und der Slavistik aus
Regensburg ist der multiethnischen Geschichte der Stadt Łódź in
Verbindung mit der deutschen und polnischen Filmgeschichte nach dem
Zweiten Weltkrieg gewidmet. Lodz soll für Studierende aus Regensburg als
historischer Ort, als Filmhauptstadt Polens und als interessante
postindustrielle Bildungsmetropole präsentiert werden. Auch der Kontakt
mit polnischen Studierenden ist ein wichtiges Ziel.
Der thematische Schwerpunkt liegt auf dem Ghetto als cineastischem
Topos, wobei die frühe fiktionalisierte Ghettogeschichte ebenso ein
Thema ist wie der Film im Sozialismus. Auch Dokumentarfilme spielen eine
wichtige Rolle – etwa zum Bau des manufaktura-Komplexes. Filmisches
Schaffen wird in seiner engen Verknüpfung mit anderen medialen Formaten
untersucht.
Das Seminar wird von Prof. Heidemann und Prof. Lecke in Co-Teaching geleitet.
Exkursion 25.5.-30.5.23
Während der Exkursion wird die Gruppe u.a. das ehemalige jüdische
Ghetto, die jüdische Gemeinde, das Centrum Dialog M. Edelman, das Muzeum
kinematografii, das älteste Stadtkino Tatry und zahlreiche Drehorte
besichtigen.
- Trainer/in: Mirja Lecke
- Trainer/in: Elisa Mucciarelli
- Trainer/in: Maximilian Lukesch
Vorlesungsverzeichnis Nr.: 33 149
Zeit: Mi 8-10
Dauer: 2 Semesterwochenstunden
Turnus: wöchentlich
Beginn: 4.5.2011
Raum: WIOS, Raum 017
Die Exkursion in die Region Flossenbürg findet vom 26.-28.05. statt und ist obligatorisch.
Im Rahmen dieses Hauptseminars werden wir uns mit der lokalen Erinnerung an das Konzentrationslager Flossenbürg beschäftigen. Dabei geht es insbesondere um die Einbindung des Konzentrationslages in das alltägliche Leben der Region. Anhand des in der heutigen Gedenkstätte vorhandenen Interviewarchivs wollen wir Einblicke in die individuellen Erinnerungen ehemaliger osteuropäischer Häftlinge an Arbeitseinsätze in den angrenzenden Dörfern gewinnen. Um diese “archivierte” biographische Perspektive um eine weitere Ebene zu ergänzen, werden wir anhand von lebensgeschichtlichen Interviews mit Bewohnern umliegender Dörfer heutige, lokale Erzählmuster über die einst “alltägliche” Präsenz der KZ-Häftlinge in den jeweiligen Dörfern aufspüren. Neben einer “mikrohistorischen” Untersuchung der individuellen bzw. privaten Nutzung der Arbeitskraft der Häftlinge, werden wir uns darüber hinaus mit der Frage nach der Funktion des KZ’s als regionalem Wirtschaftsfaktor auseinandersetzen. Dabei spielt insbesondere die regionale, wirtschaftliche Nutzung des im KZ abgebauten Granits, das als wichtigstes Baumaterial für die Bauten der NS fungierte, eine zentrale Rolle. Als Vorbereitung auf die eigenständig durchzuführenden Interviews wird das Seminar methodologische und praktische Grundlagen der lebensgeschichtlichen Interviewführung vermitteln. Die erlernten Interviewtechniken werden wir dann im Rahmen einer dreitägigen Exkursion in die umliegenden Dörfer umsetzen.
Literatur: Uwe Flick, Ernst von Kardorff, Ines Steinkke (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Hamburg 2003. Thomas Muggenthaler: „Ich lege mich hin und sterbe!“ Ehemalige Häftlinge des KZ Flossenbürg berichten. Stamsried 2005. Jörg Skriebeleit: Erinnerungsort Flossenbürg. Akteure, Zäsuren, Geschichtsbilder Göttingen 2009.
Reader: Ein ausführlicher Reader wird zu Beginn des Semesters online bei Moodle (https://elearning.uni-regensburg.de/login/index.php) eingestellt.
Hinweise: Gute Englischkenntnisse sind notwendig. Südost- und osteuropäische Sprachen sehr willkommen.
Anmeldung: Anmeldung per Email bis 01.05.2011 an friederike.kind-kovacs@geschichte.uni-regensburg.de bzw. unter https://elearning.uni-regensburg.de/
Modul/e:
GES-LA-M
GES-M 10.1
Leistungspunkte: 10
Leistungsanforderungen:
- Aktive und regelmäßige Teilnahme (inklusive Moodle- Beteiligung)
- Durchführung eines eigenen Interviews inklusive Transkription
- Hausarbeit
- Trainer/in: Friederike Kind-Kovács
Das Seminar beginnt mit dem Einführungsblock am
Freitag, den 24. April 2015 von 9:15-13:00 Uhr in Raum VG 0.14.
Die weiteren Termine sind:
1. Themenblock: Do, 11.6.15, 16:30 – 20:00 Uhr (VG 0.14)
2. Themenblock: Fr, 12.6.15, 9:15 – 13:00 Uhr (VG 0.14)
3. Themenblock: Fr, 19.6.15, 9:15 – 17:00 Uhr (VG 0.14)
4. Themenblock: Fr, 26.6.15, 9:15 – 17:00 Uhr (VG 0.14)
- Trainer/in: Hildegard Stuff
- Trainer/in: Iris Schelhorn
- Trainer/in: Andreas Mühlberger
- Trainer/in: Theresa Wechsler
Termine:
Einführungsblock: Fr, 11.4.14: 8:15-12:00 Uhr (VG 0.24)
1. Themenblock: Fr, 9.5.14, 9:15-17:15 Uhr (VG 0.14)
2. Themenblock: Sa, 10.5.14, 10:00-18:00 Uhr (VG 0.14)
3. Themenblock: Sa, 24.5.14, 10:00-18:00 Uhr (VG 0.14)
Das Seminar beginnt jeweils pünktlich zu den angegebenen Zeiten (s.t.).
Die Platzvergabe über LSF ist bereits abgeschlossen.
- Trainer/in: Hildegard Stuff
Was macht gute Führung aus? Erfolgreiche Führung ist nicht nur eine Frage eines möglichst umfangreichen Wissens- und Methodenrepertoires, sondern eine ganz wesentliche Rolle spielen die personalen und sozialen Kompetenzen einer Führungskraft. In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit der Entwicklung solcher Kompetenzen als Grundlage für eine humanistische und ethisch verantwortliche Führung: Wie gestalte ich Beziehungen? Wie führe ich mich selbst? Wo liegen meine Stärken und wo ist Potenzial für Entwicklung? Dabei greifen wir auf Modelle und Methoden der Kommunikationspsychologie und dem Konzept der Achtsamkeit zurück. Die TeilnehmerInnen erarbeiten die Themen in Kleingruppen und vermitteln diese mit kreativen Methoden. Der Seminarcharakter ist interaktiv mit Fokus auf Anwendung, Selbstreflexion und Austausch.
Die theoretischen und methodischen Grundlagen bilden die Arbeiten von Friedemann Schulz von Thun, Paul Watzlawick, Carl Rogers, Ruth Cohn und Jon Kabat-Zinn.
Dieser praxisorientierte Kurs vermittelt essentielle Kenntnisse zur Rekonstruktion der weiblichen Brust. Der Hauptteil der Online-Lernumgebung beschreibt detailliert die möglichen Varianten der Mammarekonstruktion. Dargestellt werden ein Algorithmus zur Auswahl des geeigneten Verfahrens entsprechend den Voraussetzungen der Patientin, sowie die gängigen Optionen der Implantat- und Eigengewebswiederherstellung der weiblichen Brust.
Des Weiteren umfasst der Kurs die Themengebiete der chirurgisch-relevanten Anatomie, Optionen zur Wiederherstellung des Brustwarzen-Komplex, sowie Maßnahmen zur Optimierung der Symmetrie der Brust. In Exkursen werden weitere Schwerpunkte (z.B. kongenitale Fehlbildungen der Brust, operative Therapie des Mammakarzinoms) behandelt.
Die Inhalte werden in Form von Illustrationen, Patientenbeispielen, Videosequenzen und Animationen vermittelt. Der Kurs lässt sich sequentiell erarbeiten oder als Nachschlagewerk nutzen.
Ein ausführliches Literaturverzeichnis ergänzt das Kursformat.
Das Ziel der Online-Lehrveranstaltung ist, Studierenden einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten der Brustrekonstruktion infolge eines Mammakarzinoms zu vermitteln. Das Kursangebot richtet sich primär an Studierende im klinischen Studienabschnitt. Insbesondere Teilnehmer der klinischen Famulatur bzw. Studierende im Praktischen Jahr, die im Staatsexamen entsprechende Kenntnisse nachweisen müssen, können die Lehrinhalte zur Vorbereitung und Vertiefung nutzen.
Die Lernzielkontrolle erfolgt anhand eines Abschlusstests mit Multiple-Choice- sowie offenen Fragen.
Projektförderung durch die Virtuelle Hochschule Bayern
- Trainer/in: Alexandra Anker
- Trainer/in: Magnus Baringer
- Trainer/in: Wolfgang Bauer
- Trainer/in: Silvan Klein
- Trainer/in: Marc Rüwe
- Trainer/in: Catharina Strauss
Unter Marionette findet sich im Duden die Eintragung: „Gliederpuppe, willenloses Geschöpf.“ Das Motiv der Marionette steht in der Regel für Menschen, genauer: menschliche Zustände, die als ohnmächtig, fremdbestimmt und/oder determiniert eingestuft werden. Doch früh in der Moderne (Bsp.: H. v. Kleist) zeigen sich Gegendiskurse, wird der Mangel an quälender Selbstreflexion als Gewinn an körperlicher Anmut und Unmittelbarkeit des Handelns verbucht. Anhand einer Analyse literarischer Beispiele aus dem 18.-21. Jahrhundert soll diesen mentalitätsgeschichtlichen Wandlungen des Motivs nachgegangen werden.
Feststehende Texte des Seminars sind: J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther, E.T.A. Hoffmann: Der Sandmann, H.v. Kleist: Über das Marionettentheater, G. Büchner: Leonce und Lena, Julien O. de La Mettrie: Der Mensch als Maschine, M. Shelley: Frankenstein, Philip K. Dick: Blade Runner.
- Trainer/in: Felicitas Andel
- Trainer/in: Jürgen Daiber
- Vorauslegung und Festigkeitsnachweis von zeitlich stationär sowie zeitlich-instationär beanspruchten Bauteilen
- Schraubenverbindungen, Grundlagen und Berechnung
- Grundlagen und Anordnung von Wälzlagern, Vorauslegung und Lebensdauerberechnung
- Berechnung von Bolzenverbindungen
- die richtigen Maschinenelemente für die jeweilige Anwendung auszuwählen (2) und deren Bauform zu kennen (1).
- Maschinenelemente vorauszulegen und zu dimensionieren (3).
- Festigkeitsnachweise mit Lebensdauerabschätzung zu erstellen (2) und vorhandene
- Sicherheiten zu beurteilen (3).
- Schadensbilder zu erkennen und Ausfallursachen herzuleiten (3).
Nach der erfolgreichen Absolvierung des Teilmoduls sind die Studierenden in der Lage,
- Begrifflichkeiten, Nomenklatur und Kenngrößen von Maschinenelementen anzugeben (1).
- Datenblätter und Katalogmaterial handzuhaben (2).
- den Geschichtlichen Hintergrund und die Notwendigkeit von Maschinenelementen und
- Normen zu kennen (1).
- Fachwissen und methodisches Wissen zu sicherem und normengerechten Handeln in der
- Wirtschaft anzuwenden (3).
- Produktentwicklung anzuleiten (3).
- Trainer/in: Florian Nützel
Herzlich Willkommen zur Mathematik 1!
Liebe Studierende,
willkommen zur Vorlesung "Mathematik 1" im Wintersemester 2019/2020 an der OTH Regensburg.
Informationen zur Vorlesung finden Sie im Modulhandbuch: https://www.oth-regensburg.de/fakultaeten/elektro-und-informationstechnik/studiengaenge/bachelor-elektro-und-informationstechnik.html#panel-222-0
Weitere Informationen zur Vorlesung erhalten Sie per Mail, daher überprüfen Sie bitte regelmäßig Ihr studentisches Email-Postfach.
Die Vorlesung wendet sich an Studierende der Physik im Bachelorstudiengang und im
Lehramtsstudiengang für Gymnasien.
In der Vorlesung werden Grundlagen der Funktionentheorie (komplexe Analysis) und
der Differentialgleichungen vermittelt.
Literatur: Klaus Jänich, 'Analysis für Physiker und Ingenieure',
weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben- Trainer/in: Moritz Kerz
Dieser Kurs dient der Unterstützung von Kollaboration und Kommunikation der Mentees im Max-Weber-Programm.
- Trainer/in: Felina Dincer
- Trainer/in: Cathrin Rothkopf
- Trainer/in: Silke Schworm
Was ist gute Hochschullehre?
2-stündiges Online-Treffen* über zoom: Di, 19.01. - Do, 21.01.2021*
Lernziele kompetenzorientiert formulieren
Selbstlernphase in GRIPS: Do, 21.01. - So, 24.01.2021
Lernprozesse gestalten
2-stündiges Online-Treffen* über zoom: Di, 26.01. - Do, 28.01.2021*
Selbstlernphase in GRIPS: Do, 28.01. - So, 31.01.2021
Lernfortschrittskontrolle und Feedback
Selbstlernphase in GRIPS: Mo, 22.02. - So, 28.02.2021
2-stündiges Online-Treffen* über zoom: Di, 02.03. - Do, 04.03.2021*
*Im angegeben Zeitraum stehen Ihnen drei Termine á 2 Stunden zur Auswahl. Sie können sich nach der Anmeldung im GRIPS-Kurs für einen der angebotenen Termine entscheiden.
Zielgruppe: Lehrende der Medizinischen Fakultät der Universität Regensburg
Anmeldung ab 01.12.2020
- Trainer/in: Birgit Hawelka
- Trainer/in: Zentrum Hochschuldidaktik
- Trainer/in: Thomas Neger
